Nikolai Epstein
 Nikolai Epstein
Nikolai Epstein
geboren am 21.11.1939 in Moskau, Doktortitel in Biologie. Hat bei zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen mitgewirkt. Übersetzt wissenschaftlich-technische und historische Texte sowie Belletristik aus dem Deutschen und Polnischen. Wohnt seit 1996 in Deutschland, viele Jahre war als Leiter des Kultur-, Integrations- und Begegnungszentrums KIBUZ in Potsdam tätig.
Dankbarkeit
"Ist es Wahrheit oder Märchen
Oder noch was anderes?
Es ist schwer zu erraten -
Man glaubt, dass es wahr sei…"
S.J. Marschak "Tauben"
 In letzter Zeit muss ich, dem Rat der Ärzte folgend, jeden Tag etwa eine Stunde lang an der frischen Luft spazieren gehen. Da das Gehen durch die Straßen bald ziemlich langweilig wurde, überlegte ich, wie ich meine Spaziergänge interessanter und in gewisser Weise sinnvoller gestalten könnte. Ich beschloss, dass ich an das Ufer des nahe liegenden Flusses Havel gehen und dort Enten füttern werde. Zu diesem Zweck nahm ich, als ich jetzt spazieren ging, immer ein paar Scheiben Weißbrot in einem kleinen Plastikbeutel mit.
In letzter Zeit muss ich, dem Rat der Ärzte folgend, jeden Tag etwa eine Stunde lang an der frischen Luft spazieren gehen. Da das Gehen durch die Straßen bald ziemlich langweilig wurde, überlegte ich, wie ich meine Spaziergänge interessanter und in gewisser Weise sinnvoller gestalten könnte. Ich beschloss, dass ich an das Ufer des nahe liegenden Flusses Havel gehen und dort Enten füttern werde. Zu diesem Zweck nahm ich, als ich jetzt spazieren ging, immer ein paar Scheiben Weißbrot in einem kleinen Plastikbeutel mit.
Ich fand einen bequemen Platz, wo am Ufer des Flusses unter verzweigten Bäumen ein paar Ruhebänke standen. Dort gibt es einen Holzsteg, der zu einer Plattform mit einer Bank in der Mitte führt. Holzsteg und Plattform ragen 25 bis 30 Meter in den Fluss hinein. Diese Konstruktion diente früher aller Wahrscheinlichkeit nach als Anlegestelle für Boote und kleine Yachten. Im Sommer waren gewöhnlich alle Bänke besetzt, aber im Winter blieben sie oft leer, und ich konnte meine «wohltätigen» Absichten in Ruhe ausüben, ohne jemanden zu stören.
Zuerst fütterte ich nur Enten, die mich allmählich sogar wiedererkannten. Wenn sie
mich am Ufer sahen, begannen sie mir auf dem Holzsteg zu dem Ort zu folgen, an dem ich mich normalerweise befand, und warteten geduldig darauf, dass ich aus meiner Tasche einen Brotbeutel holte und ihn öffnete. Dabei bemerkten mich Möwen, die auf dem Holzsteg saßen. Sie flogen in einem ganzen Rudel herbei, um sich die einzigartige Futter-Gelegenheit nicht entgehen zu lassen. Aber im Gegensatz zu den relativ ruhigen Enten forderten die Möwen sofort meine ganze Aufmerksamkeit. Mit lautem Rufen wirbelten sie in der Luft herum und schnappten die Brotstücke den langsamen Enten weg. Einige, die besonders «frech» waren, versuchten buchstäblich, das Brot direkt meiner Hand zu entreißen.
Als Letzte erfuhren von dem neu eröffneten «Lebensmittelpunkt» die Krähen. Zunächst verhielten sie sich sehr vorsichtig, saßen auf den Bäumen und beobachteten den Prozess der Verteilung von «Сharity food» aus der Ferne. Aber nach und nach kamen sie immer näher und näher an mich heran. Besonders mutig war eine Krähe, die mir als die Älteste erschien. Sie war die Erste, die sich auf meine Bank setzte, manchmal nur einen halben Meter von mir entfernt. Bald lernte ich sogar, sie von anderen zu unterscheiden – durch einen kleinen hellen Streifen über ihrem linken Auge. Da sie fast neben mir saß, bekam sie oft mehr Brot als ihre Freundinnen. Und sie flog nicht sofort mit einem Stück davon, sondern nahm das Essen mit Würde direkt auf der Bank ein.
Eines Tages, an einem sonnigen Wintertag, als ich zum Spielplatz kam, hielt ich an der Bank an und begann mich darauf vorzubereiten, die Vögel zu füttern. Zuerst legte ich die Tasche mit dem mitgebrachten Brot auf die Bank und nahm dann meine Sonnenbrille ab, die meine Augen nicht nur vor der Sonne, sondern auch vor dem Wind schützte. Ich wollte sie in meine Jackentasche stecken, aber aufgrund einer unvorsichtigen Bewegung blieben die Gläser an etwas hängen und so fiel die Brille auf die Bank. Durch den Aufprall flog ein Glas aus dem Brillengestell und glitt irgendwie nach unten. Ich suchte sofort nach ihm, aber es schien sich in Luft aufgelöst zu haben, und trotz gründlichster Suche konnte ich es nicht finden. Höchstwahrscheinlich war es zwischen die lose liegenden Bretter des Holzbodens ins Wasser gefallen.
Ich war sehr traurig, dass ich meine Brille nicht mehr tragen könnte. Es war eine sehr bequeme und dabei ziemlich teure Brille der Firma "Calvin Klein", die ich als Geschenk von einem guten Freund bekommen hatte. Aber was kann man machen? «Man muss verlieren können", versuchtе ich mich philosophisch zu beruhigen und begann, die mitgebrachten Brotstücke unter den Enten, Möwen und Krähen zu verteilen. Als ich das ganze mitgebrachte Futter verteilt hatte, verloren die Vögel das Interesse an mir und verschwanden allmählich. Ein paar Minuten stand ich noch auf dem Platz und beobachtete die Yachten, die über den Fluss zogen.
Als ich mich entschied, endlich nach Hause zu gehen, wandte ich mich der Bank zu,
um meine Tasche zu holen, und traute meinen Augen nicht. Auf der Bank saß, ruhig und unaufgeregt, «meine» Krähe, und vor ihr lag das dunkle Glas, das aus dem Brillengestell gefallen war! Aller Wahrscheinlichkeit nach war es nicht ins Wasser gefallen, sondern irgendwo in einer Lücke zwischen den Brettern des Holzbodens steckengeblieben. Die Krähe hatte es mit ihrem spitzen Schnabel aus dem Schlitz herausgezogen, vor sich auf die Bank gelegt und sich zufrieden danebengesetzt. Bis jetzt weiß ich nicht, was es war: das Interesse eines neugierigen Vogels an einem glänzenden Gegenstand oder eine Geste der Dankbarkeit? Ich wollte glauben, dass es eher das Zweite war. Ich ging vorsichtig zur Bank und nahm das Glas an mich. Die Krähe bewegte sich ein wenig zur Seite, flog aber nicht weg. Vielleicht erwartete sie noch etwas von mir?
Glücklich, dass das Glas gefunden worden war, eilte ich nach Hause. In der optischen Werkstatt konnte das Glas wieder in die Fassung eingesetzt werden und heute benutze ich diese Brille immer noch. Nach diesem Vorfall habe ich alle Krähen viel besser behandelt. Ich habe mich auf Google informiert, welche Leckereien die Krähen bevorzugen. Jetzt nehme ich neben dem Brotbeutel eine kleine Schachtel mit, in die ich Käsescheiben, Nüsse und Stücke von gekochtem Fleisch lege. Wenn ich nun zum Havelufer komme, um die Vögel zu füttern, gebe ich ihnen zuerst die Stücke des mitgebrachten Weißbrotes. Aber später öffne ich für "meine Krähe" die kleine Schachtel mit den leckeren Sachen. Es scheint mir, dass die Krähe sich zunehmend ruhiger verhält und sich auf der Bank immer näher an mich heransetzt. Sie nimmt die Leckerbissen von mir mit großer Würde entgegen, wohl wissend, dass sie diese ehrlich verdient hat.
(Übersetzung aus dem Russischen ins Deutsche von Viola Kladiy)
Übersetzung ind Deutsche:

Konrad Geburek geb. am 1.7.1944 in Sakrau/ Schlesien. Absolvent der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Pädagogik, Slawistik, Germanistik). Lehrer für Russisch und Deutsch, u.a. an der Kinder- und Jugendsportschule Potsdam.1985-2005 an der Volkshochschule „Albert Einstein“ Potsdam als Kursleiter in der Russisch-Sprachkundigen-Ausbildung und im Bereich Deutsch als Fremdsprache tätig, seit 1991 Fachbereichsleiter. Vorstandsmitglied im Verein „Initiative für Ausländer“ und z.Z. im erweiterten Vorstand der „Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit“ Potsdam. Engagiert in der Flüchtlingshilfe und der Partnerschaft Potsdamer Kirchengemeinden mit Menschen in Belarus.
Aus dem Zyklus „Über die Zeit und über mich“
Erinnerung ist ein wesentlicher Bestandteil
der jüdischen Wahrnehmung der Welt
Heiko Haumann
Meine „Begegnung“ mit Stalin
 Dieses Ereignis liegt schon mehr als 60 Jahre zurück, es geschah im November des Jahres 1952. Den Namen Stalins kannten damals die meisten Menschen, und zwar nicht nur in unserem Land, sondern in der ganzen Welt: „Großer Führer und Lehrer“, „Genius der ganzen fortschrittlichen Menschheit“, „Generalissimus“. Schriftsteller und Dichter wetteiferten darin, ihn in ihren Werken gar mit der Sonne zu vergleichen. Nach seinem Namen wurden Städte, Straßen, Schulen und Universitäten benannt. Zwei Jahre zuvor, während der Jubiläumsfeierlichkeiten im Zusammenhang mit seinem 70. Geburtstag, äußerte Leonid Leonow in der „Prawda“ die Idee, in der Welt eine neue Zeitrechnung einzuführen – und zwar vom Tag der Geburt Josif Stalins an.
Dieses Ereignis liegt schon mehr als 60 Jahre zurück, es geschah im November des Jahres 1952. Den Namen Stalins kannten damals die meisten Menschen, und zwar nicht nur in unserem Land, sondern in der ganzen Welt: „Großer Führer und Lehrer“, „Genius der ganzen fortschrittlichen Menschheit“, „Generalissimus“. Schriftsteller und Dichter wetteiferten darin, ihn in ihren Werken gar mit der Sonne zu vergleichen. Nach seinem Namen wurden Städte, Straßen, Schulen und Universitäten benannt. Zwei Jahre zuvor, während der Jubiläumsfeierlichkeiten im Zusammenhang mit seinem 70. Geburtstag, äußerte Leonid Leonow in der „Prawda“ die Idee, in der Welt eine neue Zeitrechnung einzuführen – und zwar vom Tag der Geburt Josif Stalins an.
Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass Stalin in der Wahrnehmung aller sowjetischen Menschen, besonders der Jugend, so etwas wie als Gott erschien, den er vielleicht sogar an Popularität übertraf. Wie auch Gott der Herr war er den Blicken der einfachen Sterblichen unzugänglich, die von ihm nur etwas hören oder seine Darstellungen auf den zahlreichen Porträts sehen konnten. Manchmal allerdings war er in Filmen und Theaterinszenierungen zu sehen. Besonders gefielen mir und meinen Altersgenossen die Kriegsfilme: „Der Schwur“, „Der Fall Berlins“, „Die Schlacht von Stalingrad“. Doch in diesen Filmen wurde Stalin natürlich von Schauspielern dargestellt, die sich nur als blasser Schatten des Originals erwiesen. Unmittelbar zu sehen bekamen Stalin nur die Mitglieder des Politbüros und der Regierung sowie seine nächsten Mitarbeiter.
Für meine Altersgenossen war er natürlich die allerhöchste Autorität in allen Fragen – streng und gerecht verfolgte er scharfsichtig den Aufbau des Kommunismus in der ganzen Welt und besonders die Intrigen seiner zahlreichen Feinde. Allen bekannt waren seine Prinzipienfestigkeit und Strenge im Kampf gegen jedwede Äußerung der Konterrevolution, gegen verleumderische Kritik und eine erlahmende Wachsamkeit. Diese Prioritäten spiegelten sich natürlich auch in unserem Schulleben wider. Unsere Lehrer achteten streng auf die „richtige“ Einstellung der Schüler und unterbanden entschlossen jede – ihrer Meinung nach – gefährliche Freigeisterei. Besonders oft passierte das im Geschichtsunterricht.
Das Leben nach dem Krieg mit seinen vielen komplizierten und für uns oft unverständlichen Ereignissen forderte viele Fragen heraus, und wir bemühten uns, darauf Antworten bei unseren Lehrern zu bekommen. Solche Fragen ergaben sich bei mir anscheinend öfter als bei anderen. Und einmal sagte unsere Geschichtslehrerin Sara Borisowna, gereizt durch meine beharrliche Neugier, zu mir: „Und du bleibst heute nach dem Unterricht hier!“ „Und warum, Sara Borisowna?“ fragte ich erstaunt. „ Bitte bleib hier, ich muss mit dir ernsthaft reden!“ Das ernste Gespräch sah, soweit ich mich erinnere, so aus: „Bist du von allen Geistern verlassen? Verstehst du, wohin deine Fragen führen? Wenn du selbst, entschuldige, so ein Idiot bist und nicht siehst, was um dich los ist und wenn du nicht an dich denken willst, dann denk' wenigstens an deine Eltern!“ Damit war das erzieherische Gespräch der Geschichtslehrerin im Prinzip zu Ende.
Daraus zog ich für mich zwei Schlussfolgerungen: erstens hörte ich auf, in der Schule Fragen zu stellen, auf welche die Lehrer sowieso nicht antworten konnten oder wollten. Und zweitens verstand ich, dass unser „glückliches“ Leben offenbar gewisse Schattenseiten hatte, von denen man nicht immer in den Zeitungen schrieb. Das heißt, es gibt eben Dinge, die man nicht immer bemerken muss. Und überhaupt ist es sehr viel besser, sich nirgends „zu weit hinauszulehnen“, weil unnötige Neugier in der Regel zu Unannehmlichkeiten führt. Jedoch erweist sich der Mensch als klug nur in seinen Absichten, wie ich später bei Erich Maria Remarque las. Doch alles der Reihe nach!
Im Moskau der Nachkriegszeit herrschte, wie im ganzen Land, ein spürbarer Wohnungsmangel. Viele Familien lebten in sogenannten Kommunalwohnungen, verschiedenen Wohnheimen, in Kellern, Kammern unterschiedlicher Art u.a.m. Unsere Familie hatte in dieser Beziehung verhältnismäßig Glück: uns gab man Ende der 40-er Jahre Wohnraum in den Iwanowskije Baracken, die in Moskau für ihre kriminellen Geschichten berühmt-berüchtigt waren. Wir bekamen zwei nicht sehr große Zimmer in einer Baracke mit der symbolischen Nummer 13. Da wohnten wir bis zu ihrem Abriss im Jahr 1958.
Wir lebten unter für die damalige Zeit typischen Bedingungen, die später von Wladimir Wysotzki (einem bekannten russischen Liedermacher – Anm. des Übersetzers) besungen wurden: „Alle lebten auf gleicher Ebene, ganz bescheiden – nach System Korridor: 38 Zimmerchen und ein Klo.“ Wir hatten ein Klosett – in der Tat ziemlich groß, für mehrere Personen – das musste für zwei große Baracken reichen, in denen es mehr als 80 Zimmer gab. Das Klo befand sich auf dem Versuchsfeld der Timirjasew-Akademie, so etwa 50 Meter von den Baracken entfernt, im Bereich der sogenannten Sanitärzone.
Von den Gästen, die uns damals besuchten, blieb mir am meisten Maria Lwowna in Erinnerung – meine Cousine väterlicherseits. Sie war im Vergleich zu mir bedeutend älter und ich nannte sie Tante Musja. Sie arbeitete in irgendeiner wichtigen Behörde, möglicherweise sogar in einem Ministerium. Wahrscheinlich bekam sie deswegen zusammen mit ihrem Mann Sinowij und Sohn Borja, der 6 Jahre jünger war als ich, ein großes Zimmer in einer 4-Zimmerwohnung direkt im Zentrum Moskaus, auf der Kujbyschewstraße (heute Iljinka), neben dem GUM-Gebäude. Eigentlich ein Glücksfall!
Dieses Zimmer sollte noch eine wesentliche Rolle bei den folgenden Ereignissen spielen, über die ich berichten möchte. Die Sache ist die, dass die Kujbyschewstraße zum Sapunow-Projesd (heute Wetoschnyj Rjad) führte – einer engen Gasse, die in gerader Linie nach ungefähr 100 Metern vom Haus, in dem Tante Musja wohnte, auf den Roten Platz einmündete. Wenn also auf dem Platz irgendwelche großen festlichen Ereignisse stattfanden, z. B. Demonstrationen oder Paraden, konnte man manche Details der Feierlichkeiten durch den schmalen Salt dieser Gasse sehen. Mein Interesse erwachte immer sofort, sobald von den Militärparaden die Rede war, die alljährlich auf dem Roten Platz am 7. November, dem Jahrestag der Oktoberrevolution, stattfanden. Ich träumte davon, sie wenigstens aus der Ferne erleben zu können – denn Fernsehen gab es damals noch nicht.
Kurz gesagt, ich bat Tante Musja darum, mich als Verwandten zu diesen Feiertagen einzuladen. Sie hatte im Prinzip nichts dagegen, sagte aber, man müsse dafür noch irgendwelche Formalitäten erledigen, da es für den Roten Platz strenge Sicherheitsvorkehrungen gäbe. Ich war natürlich erstaunt und dachte bei mir, was für eine Gefahr wohl von kleinen Kindern ausgehen könne – ich war damals ungefähr 11 Jahre alt. Doch ich schwieg und … war bereit zu warten. Die notwendigen Formalitäten zogen sich so etwa anderthalb Jahre hin. Und im Oktober 1952 sagte Tante Musja, dass jetzt alles in Ordnung sei und dass ich sie an den bevorstehenden Novemberfeiertagen besuchen könne.
Am Abend des 6. November fand ich mithilfe eines Zettels, auf dem die Adresse stand, die entsprechende Wohnung in der Kujbyschewstraße, wo ich von Tante Musja herzlich empfangen wurde. Onkel Sinowij und Borja waren nicht zu Hause, sie waren über die Feiertage auf die Datsche gefahren, um dem Lärm zu entkommen. Der Abend verlief ohne besondere Zwischenfälle, bis auf den Besuch gewisser Leute, die alle die gleichen dunklen Mäntel mit Persianerkragen trugen. Sie erschienen bei uns im Zimmer so gegen 10 Uhr abends. Ihre Aufgabe bestand darin zu überprüfen, ob sich in der Wohnung nicht etwa Fremde aufhielten. Da meine Tante Musja eine entsprechende Erlaubnis vorweisen konnte, musterten sie mich nur mit einem strengen Blick, sagten nichts und verließen uns bald wieder. Ich atmete erleichtert auf, ging schlafen und erwartete freudig erregt den nächsten Morgen.
Und der kam mit festlichen Märschen und Liedern, die unablässig aus den Lautsprechern tönten. Auch Lobsprüche erklangen zu Ehren „unserer geliebten“ Kommunistischen Partei und ihres Führers, Lehrers und treuen Leninisten, des teuren Genossen Stalin. Nachdem ich das Frühstück hastig verschlungen hatte, lief ich auf den Hof hinaus, um mir einen passenden Beobachtungsplatz zu sichern. Doch hier erwartete mich eine riesengroße Enttäuschung! Alle Zwischenräume zwischen den Häusern am Sapunow-Projesd bis hin zum Roten Platz waren durch Soldaten abgeriegelt. Und alle 30 Meter standen Patrouillen quer zur Gasse. Sie kontrollierten die Passierscheine der Ehrengäste, die zur Teilnahme an den Festlichkeiten auf dem Roten Platz eingeladen waren.
Der Hof unseres Hauses war zu diesem Zeitpunkt bereits voller Kinder, hauptsächlich Jungen in meinem Alter, die immer wieder versuchten, sich durch eine Lücke zwischen den Soldaten zu drängeln, um einen Blick auf das, was auf dem Roten Platz gerade geschah, zu erhaschen. In der Regel wurden diese Versuche schnell unterbunden – die Soldaten brachten die übermäßig neugierigen Kinder unverzüglich hinter die Absperrung zurück. Die Lage schien vollkommen hoffnungslos. Es war ziemlich unrealistisch zu hoffen, man könne von unserem Hof etwas mehr als die Rücken der Soldaten erblicken.
Und da bemerkte ich einen Jungen, der in der Nähe stand. Er versuchte nicht wie die anderen, durch die Kette der Soldaten hindurchzuschlüpfen, sondern stand ganz gelassen da, als ob er auf irgendetwas wartete. Plötzlich erschien in der Mitte der Straße eine ältere, elegant gekleidete Frau, die allem Anschein nach einen Passierschein für den Roten Platz hatte. Da überwand der Junge rasch die Soldatenkette, lief auf die Frau zu und bat mit flehender Stimme: Tantchen, nehmen Sie mich bitte mit! Die Frau lachte, legte ihm eine Hand auf die Schulter und sagte fröhlich: Na denn, gehen wir! Und beide verschwanden aus dem Blickfeld hinter der Patrouillenkette. Das war einfach genial! Und ich schöpfte wieder neue Hoffnung.
Offenbar kannten viele Kinder diesen Trick. Jedenfalls wurde ich bald wieder Zeuge ähnlicher „Durchbrüche“. Jetzt wird es Zeit! - entschied ich: jetzt oder nie! Um sie abzufangen, eilte ich auf eine Gruppe von älteren Leuten zu, die mit Orden und Medaillen behangen waren und ebenfalls auf den Roten Platz wollten. Vor Aufregung hatte ich eine trockene Kehle und konnte kaum den vorbereiteten Text hervorbringen. Trotzdem erhielt ich ein verständnisvolles Lächeln zur Antwort und man lud mich ein, sich ihnen anzuschließen. Ich spürte vor Angst kaum meine Füße unter mir, als ich mich zusammen mit meinen Begleitern den Patrouillen näherte, welche die Passierscheine kontrollierten. Zum Glück schenkten die Wachposten mir keinerlei Aufmerksamkeit. Dann passierten wir den nächsten Kontrollpunkt und noch einen, und noch... Und plötzlich befand ich mich auf dem von zahlreichen Porträts und Transparenten geschmückten Roten Platz, an den Tribünen, die am GUM-Gebäude aufgestellt waren, voll von festlich gekleideten Gästen.
Das Gefühl von Freude, aber auch Unwirklichkeit dessen, was sich vor meinen Augen ereignete, lässt sich schwer in Worte fassen. Ich befinde mich auf dem Roten Platz und werde bald die Militärparade sehen. Einfach fantastisch! Schade, dass ich davon keinem werde erzählen können, denn niemand würde es glauben. In die Realität stieß mich eine durch Lautsprecher verstärkte Stimme zurück. Man forderte die Gäste auf, bald ihre Plätze in dem ihnen zugewiesenen Sektor einzunehmen. Mein irreales Hochgefühl wich plötzlich einem ganz realen Entsetzen. Ich sah, dass die Tribünen am GUM-Gebäude in Sektoren eingeteilt waren, jeder von ihnen hatte eine eigene Nummer und die Sektoren waren voneinander durch Metallketten abgetrennt. Diese Metallketten befanden sich in der Höhe von etwa einem Meter und waren an Betonpfosten befestigt. An den Zugängen zu den Sektoren standen wieder Militärpatrouillen, die nun zum letzten Mal die Passierscheine kontrollierten.
Zu diesem Zeitpunkt waren meine Wohltäter, die mich auf den Roten Platz gebracht hatten, irgendwo auf den Tribünen verschwunden. Und ich blieb allein auf dem fast leeren Platz zwischen den Sektoren zurück. Ich erwartete mit Schrecken die unvermeidliche Enttarnung. In meinem Kopf kreisten schon Varianten möglicher Konsequenzen: Verhaftung, Gefängnis, weinende Eltern und Verwandte, Ausschluss aus der Schule. Und die Geschichtslehrerin Sara Borisowna würde erzählen, wie sie versucht hatte, mich zu retten.... Was tun?
Doch zum Glück gibt es, wenn man nur ausreichend nachdenkt, aus den meisten kritischen Lebenslagen einen annehmbaren Ausweg. Und er wurde auch diesmal gefunden. Ich wartete ab und als die Patrouille im nächsten Sektor gerade damit beschäftigt war, die verspäteten Gäste zu kontrollieren, kroch ich unter der Absperrkette hindurch, zerriss mir dabei zwar das Hemd, kratzte die Haut auf meinem Rücken blutig und fand mich, als ob nichts geschehen wäre, innerhalb des Sektors wieder. So gelang es mir, Gott sei Dank, die unangenehmen Konsequenzen der ersten Variante zu vermeiden.
So war ich also auf dem Roten Platz, fast unmittelbar gegenüber dem Lenin-Mausoleum, und wartete, noch zitternd wegen der überstandenen Abenteuer, auf den Beginn der Parade. Da erschien auf der Tribüne von der rechten Seite her, wie auf den Wink eines Zauberstabes, plötzlich der weltbekannte Mann von nicht großer Gestalt in Marschalluniform und Schirmmütze. Ja, das war ER! Stalin!!! Langsam ging er mit lässig erhobener Hand die ganze Tribüne entlang, näherte sich der unten links am Mausoleum stehenden Gruppe von Marschällen und Admiralen und grüßte sie durch militärische Ehrenbezeigung. Danach kehrte er zur Mitte der Tribüne zurück und grüßte mit einer freundlichen Geste die Gäste, die sich auf den Tribünen des Roten Platzes befanden. Von den Tribünen antworteten ohrenbetäubende Schreie und, verstärkt durch Lautsprecher, Hurrarufe zu Ehren des großen Genossen Stalin, die in lang anhaltende, nicht enden wollende Ovationen übergingen.
Nach kurzer Pause erschienen auf der Mausoleumstribüne fast unbemerkt die Ehrengäste: zunächst eine Gruppe von Militärführern in goldbestickten Uniformen, mit Orden und Medaillen behangen. Sie nahmen links neben Stalin Aufstellung. Rechts vom Führer standen Leute in Mänteln und mit Hüten. Unter ihnen erkannte ich einige Mitglieder des Politbüros des ZK und Minister, die mir von Porträts aus den Zeitungen bekannt waren. Außer ihnen standen neben Stalin auch einige mir unbekannte Personen – offensichtlich handelte es sich um Leiter von kommunistischen Bruderparteien.
Aber, ehrlich gesagt, ich bemühte mich nicht besonders, alle Leute, die neben Stalin auf der Tribüne des Mausoleums standen, zu betrachten. Ich schaute nur auf ihn allein, auf Stalin! Ist das wirklich er? Und sehe wirklich ich, ein kleiner jüdischer Junge aus den Iwanowskije Baracken, den genialen und allmächtigen Generalissimus, den Genossen Stalin? Nein, das ist unmöglich. Das ist wahrscheinlich ein Traum, irgendeine irreale Vision aus einer anderen Welt – eine Erscheinung, die jeden Augenblick wieder verschwinden kann. So etwas gibt es nur einmal im Leben, und ich habe kein Recht, mich von etwas anderem ablenken zu lassen, nicht einmal von der Militärparade. Denn einzig diesen Moment will ich für immer in meinem Gedächtnis behalten – ich sehe den großen Stalin!
Nachwort
Seit den Ereignissen von damals sind viele Jahre vergangen. Unser Leben bewegt sich schnell, manchmal zu schnell, weiter voran. Und unsere Gefühle, aber auch die Einstellung zu den Ereignissen, deren Zeugen wir sind, unterliegt häufig einer grundlegenden Neubewertung. So war es auch in diesem Fall. Meine anfängliche Begeisterung für das „Treffen“ mit Stalin auf dem Roten Platz verlor erheblich ihren Glanz bereits in den nächsten Monaten. Das ist noch harmlos ausgedrückt. Denn da passierte etwas Schreckliches im unmittelbaren familiären Umfeld: Papas Bruder Alexander Naumowitsch (Onkel Aba), Dozent an einem Technikum, wurde aufgrund einer lügenhaften Denunziation wegen angeblicher Verleumdung der „sowjetischen Realität“ in Iwanowo verhaftet. Mein Vater versuchte, dem Untersuchungsrichter zu erklären, dass es sich um ein Missverständnis handele – doch leider ohne Erfolg. Daraufhin erlitt mein Vater einen Herzinfarkt, von dem er sich nicht mehr erholen konnte.
Danach, etwa zwei Monate nach der Parade am 7. November, wurde die ganze Welt am 13. Januar 1953 durch eine TASS-Meldung erschüttert, die in allen zentralen Zeitungen veröffentlicht und ständig im Radio übertragen wurde. Da war die Rede von der Enthüllung einer verbrecherischen Organisation jüdischer Ärzte in der UdSSR. Diese hätten im Auftrag ausländischer Geheimdienste und der internationalen jüdischen bürgerlich-nationalistischen Organisation „Joint“ in niederträchtiger Weise Mitglieder der Regierung der UdSSR und hochrangige sowjetische Militärführer umgebracht. Das war der Beginn einer viel Aufsehen erregenden antisemitischen Kampagne in der UdSSR. Als Folge der täglichen Publikationen in der Presse begann eine antijüdische Hysterie. Es verbreiteten sich Gerüchte über eine bevorstehende Deportation aller Juden aus den zentralen Gebieten der Sowjetunion nach Birobidschan und in entlegene Gebiete Sibiriens. Die Vertreibung und andere Aktionen gegen die Juden sollten Ende Februar beginnen. Das wäre mit unabsehbaren Folgen verbunden gewesen.
Doch am 5. März 1953 verkündete der Chefsprecher des Sowjetischen Rundfunks, Jurij Levitan, unter den Klängen von Trauermusik mit feierlicher und tief bewegter Stimme, die Millionen von Menschen kannten, dass „heute, um 9 Uhr und 50 Minuten, nach schwerer Krankheit das Herz des Gefährten und genialen Fortsetzers der Sache Lenins, des mutigen Führers und Lehrers der Kommunistischen Partei und des sowjetischen Volkes – Josif Wissarionowitsch Stalins – aufgehört hat zu schlagen!“ Als ich das hörte, war mein erster Gedanke, der mir durch den Kopf ging: Es gibt doch einen Gott – trotz alledem!
Potsdam, September 2016
(Übersetzung aus dem Russischen ins Deutsche Konrad Geburek )
Mein Diplom-Praktikum
 Damals studierte ich im 4. Studienjahr an der Moskauer Landwirtschaftlichen Timirjasew-Akademie. Nach dem Wintersemester stand für alle Studenten ein halbjähriges Diplom-Praktikum an. Viele von uns freuten sich schon darauf. Denn erstens bedeutete dies eine willkommene Abwechslung zum bereits etwas lästigen Studium und zweitens begann damit eine Zeit mit mehr Selbstständigkeit, neuen Begegnungen, ja vielleicht sogar mit irgendwelchen romantischen Abenteuern. Wenn man den Erzählungen der älteren Semester Glauben schenken konnte, dann gab es letztere tatsächlich nicht selten.
Damals studierte ich im 4. Studienjahr an der Moskauer Landwirtschaftlichen Timirjasew-Akademie. Nach dem Wintersemester stand für alle Studenten ein halbjähriges Diplom-Praktikum an. Viele von uns freuten sich schon darauf. Denn erstens bedeutete dies eine willkommene Abwechslung zum bereits etwas lästigen Studium und zweitens begann damit eine Zeit mit mehr Selbstständigkeit, neuen Begegnungen, ja vielleicht sogar mit irgendwelchen romantischen Abenteuern. Wenn man den Erzählungen der älteren Semester Glauben schenken konnte, dann gab es letztere tatsächlich nicht selten.
Die Diplomanden hatten die komplizierte Aufgabe, einen passenden Praktikumsplatz und eine Anstellung selbst zu finden, die es ermöglichte, entsprechendes Material für die Diplomarbeit zu sammeln. Außerdem sollte es eine planmäßige Stelle sein, d.h. eine bezahlte Arbeit, weil wir während der Praktikumszeit kein Stipendium erhielten. Doch ohne Geld kann man nirgendwo leben.
Für mein Diplom-Praktikum schlug man mir einen Ort im Kreis Sarajskij, Gebiet Moskau, vor. Der Direktor einer der Sowchosen (Staatsgut, Anm. des Übersetzers), selbst Absolvent unserer Akademie, war bereit, mich für ein Praktikum einzustellen, allerdings gab es nur eine freie Planstelle, nämlich die eines Tierarztes in einer entlegenen Sowchose. Dies bereitete mir sogleich zwei Probleme.
Ehrlich gesagt, die Anstellung als Tierarzt hätte mir sehr zugesagt, weil das Spezialfach „Tiermedizin und Geburtshilfe“, das ich einige Semester studiert hatte, mir schon immer sehr gefiel. Dies hatte ich den glänzenden Vorlesungen des Lehrstuhlleiters, Prof. W.S. Schipilow, zu verdanken. Doch da ich leider kein Tierarzt-Diplom hatte, wurde beschlossen, mich als Tierarztassistent einzustellen. Das andere Problem bestand darin, dass meine Diplomarbeit der Forschungsthematik des Instituts für Züchtung und Genetik entsprechen sollte, wo ich schon einige Jahre Teilnehmer an einem wissenschaftlichen Spezialkurs war.
Eine Kompromisslösung wurde bald gefunden. Neben meiner Hauptarbeit als Tierarztassistent sollte ich mich mit der Einrichtung einer Stelle zur künstlichen Besamung von Kühen beschäftigen. Das galt damals als eine neue und progressive Technologie in der Tierzüchtung. Dieses Thema entsprach dem Forschungsprofil des Instituts und deshalb gab es von dieser Seite auch keinen Widerspruch.
So traf ich an einem Apriltag des Jahres 1961 im Zentralbüro der Sowchose N. im Kreis Sarajskij ein. Der Direktor stellte mich den Fachkräften vor und beauftragte den Filialleiter, mich darüber aufzuklären, welche Aufgaben in seiner Abteilung auf mich zukämen und welche Verpflichtungen ich hätte. Außerdem sollte er für mich eine annehmbare Unterkunft besorgen.
Das Wohnungsproblem wurde schnell gelöst. Man sagte mir, dass ich bei einer Arbeiterin der Feldbaubrigade wohnen könne, nennen wir sie Elvira Sacharowna. Sie war einverstanden, mich für die Zeit des Praktikums als Untermieter aufzunehmen. Ich sollte ohne Zögern die angegebene Adresse aufsuchen, um gleich das Nötige zu klären. Allerdings hatte mich das Verhalten der Angestellten im Büro etwas verunsichert, denn sie verabschiedeten mich mit einem sonderbaren Lächeln. Doch ich entschied, solchen Nebensächlichkeiten keine besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Die Wohnung befand sich in der Nähe des Zentralbüros, und zwar in einem finnischen Häuschen mit einem Zimmer, einer kleinen Küche und einem Windfang. Die Hausherrin, eine Frau mittleren Alters von stattlicher Größe, sagte mir, dass das Problem meiner Unterbringung bereits mit der Sowchose-Leitung abgesprochen und alles in Ordnung sei. „Und wo werde ich wohnen?“ fragte ich erstaunt, denn ich sah nur ein einziges Zimmer. „Wie denn wo?“ wunderte sie sich ihrerseits. „Den kleinen Schreibtisch werden wir hier ans Fenster stellen, und dein Bett wurde schon geliefert – das stellen wir hierhin, neben unser Bett.“ In diesem Moment trat der Mann der Hausherrin ins Zimmer und wir machten uns bekannt. Er sagte, er heiße Tolik . Was Körpermaße und Alter betraf, schien die Frau ihren Mann um das Doppelte zu übertreffen. Aus den Gesprächen mit Tolik entnahm ich, dass er erst seit kurzem hier wohnte. Elvira Sacharowna hatte er vor einiger Zeit während des Militärdienstes hier in der Nähe kennengelernt. Danach beschloss er, bei Elvira Sacharowna zu bleiben und, wie man sagt, eine Familie zu gründen. So waren die Eheleute gewissermaßen noch Jungverheiratete. Tolik machte auf mich den Eindruck eines ruhigen und sogar etwas schüchternen Menschen. Er sprach langsam und leise, als ob er sich die ganze Zeit irgendwie genierte.
Es sei vorab gesagt, dass ich es nicht lange bei ihnen aushielt. Erstens wegen meines Bettes, das sie tatsächlich fast neben ihrem Ehebett aufstellten. Tolik, der mir anfangs still und sogar wie schläfrig erschien, lebte merklich auf, wenn es auf die Nacht zuging. An Schlafen in einem Zimmer mit ihnen war überhaupt nicht zu denken. Das Ehepaar schlief lange nicht ein, sie tuschelten und kicherten immerzu. Na und dann... Ach, diese Betten mit Stahlfedern – ein Graus! Am Anfang versuchte ich einzuschlafen, indem ich mit dem Kopf unter die Bettdecke kroch. Dann wickelte ich den Kopf in meine Jacke ein und legte oben noch ein Kissen drauf. Doch leider alles vergebens! – Und noch etwas machte mir das Leben schwer: die ständigen Fragereien von mir zum Teil bekannten, aber auch unbekannten Sowchose-Arbeitern – wie es sich denn so lebe bei Elvira Sacharowna ... Im Dorf kursierten Legenden um Tolik, und nun interessierten sich die Leute für die Details. Das war am Ende einfach zu viel!
Kurz gesagt, nach ein paar Tagen erschien ich im Büro und erklärte dem Verwalter, dass ich bereit sei, wo auch immer zu wohnen: in einem Zelt, im Keller oder in irgendeinem Holzschuppen – egal, aber ich könne auf gar keinen Fall länger bei Elvira Sacharowna bleiben, denn die psychischen Belastungen und ständige Schlaflosigkeit seien einfach nicht mehr auszuhalten. Bei dem Wort „Holzschuppen“ wurde der Verwalter plötzlich munter und sagte, dass er eine Idee habe, das Problem zu lösen. Im Zentrum des Dorfes, wo ich arbeitete, stand eine vernachlässigte Holzhütte, die früher einmal als Lebensmittelladen gedient hatte. Später wurde im Dorf ein modernes Geschäft gebaut – und der alte Lebensmittelladen blieb leer und wartete auf bessere Zeiten. So schlug man mir vor, die Holzhütte vorübergehend zu beziehen.
Die Räume, die ich besichtigte, riefen bei mir, ehrlich gesagt, nicht gerade große Begeisterung hervor. Von den Möbeln war an einer Wand nur ein Regal mit drei breiten Böden erhalten, die wahrscheinlich früher zur Ablage von Backwaren dienten. Am Fenster stand ein kleiner Ladentisch und an der Decke hing eine Lampe, umgeben von einem Drahtgeflecht, das wohl von einem abgebrannten oder zerfallenen Lampenschirm stammte. Eine Heizung gab es natürlich nicht, doch das Mitte April einsetzende warme Wetter ließ mich darauf hoffen, dass es eine Chance zum Überleben für mich gab.
Ich lebte mich schnell im neuen Haus ein und gewöhnte mich mit der Zeit daran, ja es begann mir sogar irgendwie zu gefallen. Natürlich ließen die Wohnbedingungen einiges zu wünschen übrig, doch mein neues Heim gewährleistete mir Ruhe und ich konnte mich meiner Diplomarbeit zuwenden. Mein Bett richtete ich mir auf dem obersten Boden des Backwaren-Regals ein, auf dem mittleren bewahrte ich meine Kleidung und Esswaren auf, unten die Bücher und Tierarzt-Instrumente für die Notfallhilfe.
Meine Arbeit bestand, wie ich bereits sagte, aus zwei Teilen. Erstens gehörte zu meinen Pflichten als Tierarztassistent die Betreuung der Milchfarm, wo die Kühe gehalten wurden, sowie der großen Schweinefarm. Bei der Arbeit in der Milchfarm handelte es sich im Wesentlichen um die Kontrolle der hygienischen Bedingungen, um Hilfe bei komplizierten Kälbergeburten, um Behandlung von Eutererkrankungen sowie Verdauungsstörungen und verschiedener Verletzungen. In der Schweinefarm gehörte neben der Hygienekontrolle zu meiner Hauptaufgabe, Ferkel zu kastrieren, was ich, ohne mich zu loben, vorzüglich beherrschte. Die kleinen zwei Monate alten Ferkel bekamen es kaum mit, was mit ihnen passierte und dass nunmehr ihr Leben in neuen Bahnen verlaufen würde. Sie quiekten ein bisschen, doch sie beruhigten sich bald und gaben sich weiter ihren üblichen Beschäftigungen hin. Nach einigen Stunden kontrollierte ich ihr Befinden und vermerkte im Kontrollbuch, ob sich ihr Zustand im grünen Bereich der physiologischen Norm befand.
Interessanter für mich war die Arbeit im Zentrum für künstliche Besamung. Ich war an der Organisation dieser Stelle unmittelbar beteiligt. Das Zentrum betreute alle Filialen der Sowchose, die sich in ziemlicher Entfernung voneinander befanden. Für die Arbeit in diesem Zentrum wurden mir zwei Pferde zugeteilt, die der Pferdewärter des Dorfes jeden Morgen zu meinem Haus führte und an der Außentreppe festband. Die große Stute mit grauem Fell hieß Olga Nikolajewna, das zweite war ein kleinerer brauner Wallach mit dem Namen Hitler.
Bei meiner Arbeit in diesem Zentrum ging es um Folgendes: Das Sperma von hochwertigen Zuchtbullen wurde mir von der mit importierter Hightech ausgerüsteten Samenbank aus der Kreisstadt angeliefert. Zu meinen Aufgaben zählte die mikroskopische Qualitätskontrolle der gelieferten Muster. Diese mussten verdünnt und dann entsprechend den Bestellungen an die Farmen in der erforderlichen Menge weitergeleitet werden. Für den Transport hatte ich einen großen Rucksack zur Verfügung, in dem sich ein Kühlbehälter sowie spezielle Instrumente befanden. Ich packte mir den Rucksack auf den Rücken, stieg in den Sattel und ritt auf Olga Nikolajewna oder Hitler los.
Die Technologie der genauen Prozedur werde ich nicht beschreiben – die ist eigentlich recht unkompliziert und in den Details standardisiert. Nicht „standardisiert“ waren hingegen die Kommentare der Melkerinnen, die mit unverhohlenem Interesse meine Handgriffe beobachteten. Die etwas Älteren schüttelten bekümmert den Kopf, empörten sich lauthals und machten mir Vorwürfe, ich würde ihre Lieblinge sozusagen eines von der Natur geschenkten Vergnügens berauben. Die jungen Melkerinnen beobachteten ebenfalls mit Interesse das Geschehen, doch sie waren in ihre eigenen Gedanken versunken und enthielten sich jeglichen Kommentars.
Die Kühe ließ das alles kalt. Manchmal drehten sie ihren Kopf in meine Richtung, um zu schauen, was ich da wohl machte. Doch weil der Sinn des Geschehens für sie verborgen blieb, blickten sie bald gelangweilt, ja gleichgültig, und sie wandten sich wieder dem Futtertrog zu.
Der Feind Nummer eins in meiner Abteilung war der in der äußeren Box stehende Bulle Mischka. Gereizt brüllte er los und glotzte mich böse an, wenn ich vorbeiging. Obwohl er von Drahtseilen festgehalten wurde, war ich stets darauf bedacht, ihm nicht zu nahe zu kommen.
Im Großen und Ganzen verlief mein Praktikum recht erfolgreich – ein Ende war bereits abzusehen. Ich konnte umfangreiches wissenschaftliches Material, dokumentarische Fakten und auch Fotos sammeln, was zur Abfassung der Diplomarbeit vollkommen ausgereicht hätte. Ich war dennoch nicht ganz zufrieden. Irgendwas fehlte noch; eigentlich hatte ich von diesem Praktikum noch etwas anderes erwartet. Schließlich wurde mir klar: es fehlte an romantischen Abenteuern und geheimnisvollen Rendezvous, woran sich die älteren Studenten doch so gern erinnerten und uns davon erzählten.
Mag sein, dass jemand da oben meine Gedanken erhört hatte...
Bis zum Ende des Praktikums blieben nur noch wenige Tage, als ich plötzlich im Zentralbüro von einer Neuigkeit hörte: aus einem Moskauer Institut kommen demnächst Studenten zum Ernteeinsatz! Mit der Ankunft der Studenten änderte sich das Dorfleben schlagartig. Auf den Straßen waren immer mehr Menschen zu sehen, im Dorfklub begann man jeden Abend Kinofilme zu zeigen, im Anschluss daran organisierten die Studenten Tanzveranstaltungen. Ich wollte nicht auf dieses fröhliche Leben verzichten, und so suchte ich nach Möglichkeiten, nach Beendigung des Praktikums noch für eine gewisse Zeit im Dorf zu bleiben.
Eigentlich standen mir noch zwei Wochen gesetzlichen Urlaubs zu, sodass ich zeitlich nicht besonders eingeschränkt war. Wegen des Wohnraums konnten wir uns problemlos einigen. Ich sagte dem Verwalter, dass ich noch ein paar Tage an meiner alten Stelle wohnen bleiben müsste, um die gewonnenen Daten auszuwerten. Schlechter stand es um die Finanzen, da ich ja die Arbeit offiziell beendet hatte, bekam ich auch keine Vergütung mehr. Doch ein Ausweg war bald gefunden: ich beschloss, mich privat praktisch zu betätigen. Die Sache war nämlich die – fast jede Familie im Dorf hatte eine kleine Privatwirtschaft. Man hielt Tiere, meist Schafe, Hühner und natürlich auch Schweine. Logischerweise hatten die Schweine auch Ferkel, die kastriert werden mussten. Und meine Stelle als Tierarztassistent war noch nicht neu besetzt und man wäre gezwungen gewesen, für die Kastration Spezialisten von anderen Filialen zu besorgen. Das wiederum hätte Geld gekostet.
So gab es für mich keinerlei Konkurrenz. Ich bot meine Dienstleistungen praktisch kostenlos an und lehnte es entschieden ab, Geld für meine Arbeit zu nehmen. Allerdings lud man mich gewöhnlich zum Essen ein, wenn ich abends kam, um den Zustand der operierten Ferkel zu überprüfen. Manchmal gab es sogar ein Glas Hochprozentigen, den einige lokale Witzbolde auf den Namen „Freundschaftswein“ tauften. Dabei spielten sie auf die Zusammensetzung an, nämlich den kubanischen Zucker und die russische Hefe. Es bleibt noch zu ergänzen, dass mir die barmherzigen Hausfrauen häufig die Reste vom Abendessen zum Mitnehmen einpackten. So kann man sich mein Hochgefühl von Behaglichkeit und Freiheit lebhaft vorstellen, in dem ich mich befand.
Und dann passierte doch noch das, was ich unbewusst ersehnt hatte. Als ich eines Abends wieder zu einem „Kontroll“-Essen ging, begegnete mir unterwegs zufällig eine junge Studentin, die mir bescheiden, sympathisch und freundlich gestimmt erschien. Für mich selbst überraschend fasste ich mir ein Herz und, ohne auf einen Erfolg zu hoffen, fragte ich sie, ob sie nicht mit mir zu Abend essen wolle. Zu meinem Erstaunen war sie sofort einverstanden. Als wir uns dem bewussten Haus näherten, bat ich die junge Frau einen Moment zu warten. Ich begrüßte die Hausfrau und machte die Visite bei meinem Tagespatienten. Erwartungsgemäß war mit ihm alles okay. Der Hausfrau, die mich – wie üblich – zum Essen einlud, eröffnete ich, dass ich nicht allein gekommen sei. Daraufhin sagte sie, dass ihre Einladung selbstverständlich für uns beide gelte. Das Abendessen war sehr gelungen und die junge Frau war so begeistert, dass sie für Zwei aß und trank.
Nachdem wir uns bei der Gastgeberin bedankt und verabschiedet hatten, gingen wir in angeheiterter Hochstimmung auf die Straße. Es war ein angenehmer, warmer Sommerabend und obwohl die Sonne schon unterging, war es noch ziemlich hell. Natürlich konnte ich als Mann, der weiß, was sich gehört, die junge Frau in diesem Zustand nicht allein lassen. Unsere Füße trugen uns wie von selbst zu meiner „Hütte“. Ich kam gar nicht dazu, die Tür zu öffnen. Bevor ich irgendetwas zu erklären versuchte, war sie schon entschlossen ins Innere getreten. Sie lief sofort zur Wand mit den Holzbrettern. Eine Sekunde später lag ihr langer dunkler Rock schon auf dem Boden. Im nächsten Augenblick kletterte sie mit der Leichtigkeit einer trainierten Sportlerin auf den obersten Regalboden, meine bescheidene Bettstatt. Mit klopfendem Herzen folgte ich ihr und ich schaffte es kaum, mich meiner Sachen zu entledigen. Das Licht schalteten wir lieber nicht ein, um die Aufmerksamkeit neugieriger Passanten nicht auf uns zu ziehen.
Bevor sie noch am selben Abend wegging, verabredeten wir uns für den nächsten Tag. Doch dann, am nächsten Morgen, schien die Erinnerung an die abendliche Begegnung schon irgendwie verblasst. Und als wir uns trafen, schauten wir uns einander ziemlich verlegen an. Zu meinem Schrecken erinnerte ich mich nicht einmal mehr an ihren Namen und wusste nicht, wie ich sie anreden sollte. Hieß sie vielleicht Mila? Um aus dieser unangenehmen Situation herauszukommen, wählte ich die Höflichkeitsform und sagte etwas in der Art wie: „Haben Sie vielen Dank für den gestrigen Abend.“ Und ganz unpassend fügte ich hinzu, dass ich bald abfahren müsse. „Schade, dass Sie wegfahren“, brachte sie vielleicht auch aus Höflichkeit hervor. „Aber heute Abend könnten wir uns doch noch einmal treffen?“ schlug ich schüchtern vor. „Gut“, willigte sie ein. Wir verabredeten Ort und Zeit des neuen Treffens und gingen auseinander.
Als der Abend näher kam, war meine Stimmung plötzlich ganz verändert. Ich wollte unbedingt dieses Mädchen wiedersehen und beschimpfte mich selber wegen meines idiotischen Benehmens. Ich lief in meiner Hütte aufgeregt von einer Ecke zur anderen und konnte keine Ruhe finden. Die Zeit zog sich in die Länge und ich schaute immer wieder auf die Uhr. Lange vor dem festgesetzten Termin wartete ich schon auf sie an der vereinbarten Stelle. Doch sie erschien nicht mehr...
Am nächsten Morgen bemühte ich mich, möglichst schnell alle Angelegenheiten in der Buchhaltung der Sowchose zu erledigen, meine Sachen zu packen und nach Hause zu fahren.
Mein Praktikum war zu Ende.
Potsdam, November 2016
(Übersetzung aus dem Russischen ins Deutsche Konrad Geburek )
Bubentschik, Brusnitschka und die Miliz
1. Arbeitsstellen-Zuweisung
Nachdem ich das Studium an der Zootechnischen Fakultät der Timirjasew-Akademie beendet und meine Diplomarbeit erfolgreich verteidigt hatte – man schlug mich sogar für eine Aspirantur vor – wurde mir eine Arbeitsstelle im Smolensker Gebiet vorgeschlagen. So fuhr ich nach Smolensk zur Gebietsverwaltung für Landwirtschaft, wo mich der Leiter B. A. Solowejtschik empfing. Er stellte mir viele Fragen zum Studium, zu meinen Interessen und auch zu meinem Lebenslauf. Als er erfuhr, dass ich Moskauer bin, wurde er, wie mir schien, etwas nachdenklich. Er riet mir ein wenig spazieren zu gehen und nach einer halben Stunde wiederzukommen. Als ich wieder bei ihm war, sagte er, dass die Frage meiner Arbeitsstelle geklärt sei und ich in den Kreis Gshatsk fahren sollte. Der entschiedene Ton, mit dem er das sagte, ließ mich aufmerken, und ich fragte: „Weshalb gerade dieser Kreis?“ – „Der ist Moskau am nächsten“, antwortete er kurz und bündig.
In der Gshatsker Verwaltung für Landwirtschaft wurde ich freundlich vom Leiter empfangen. „Es freut mich, Sie kennenzulernen“, sagte er. „Wir brauchen dringend junge Spezialisten. Man hat mich aus der Gebietsverwaltung angerufen, sodass ich schon viel von Ihnen weiß. Wir haben beschlossen, Sie in den Kreis Tjomkino zu schicken, und zwar in die Sowchose N., wo Sie einstweilen als Tierzüchter tätig sein werden.“ Der Name des Kreises machte mich etwas stutzig (tjomnyj = dunkel, Anm. des Übers.) und ich fragte, ob es eigentlich eine Möglichkeit gäbe, seinen Arbeitsplatz frei zu wählen. „Beunruhigen Sie sich nicht“, beschwichtigte mich der Verwaltungsleiter, „das ist eine unserer besten Sowchosen, und der dortige Direktor ist ein sehr angenehmer Mensch. Ich bin überzeugt, er wird Ihnen gefallen.“ Und er fügte offenbar als Hauptargument hinzu: „Außerdem liegt diese Sowchose Moskau am nächsten.“
2. Ankunft in Tjomkino
Einige Tage später machte ich mich mit meinem kleinen Köfferchen auf den Weg ins Kreiszentrum, die Siedlung Tjomkino – den Ort meiner künftigen Tätigkeit. Der Weg aus Moskau war ziemlich
lang: erst mit dem Zug bis Wjasma, von dort mit einer Kleinbahn, die zweimal am Tag fuhr, noch ein paar Stunden bis zum Kreiszentrum. Als man bei der Einweisung davon sprach, der Ort läge in der Nähe Moskaus, hatte man wahrscheinlich die Luftlinie auf der Landkarte gemeint.
Irgendwie erreichte ich schließlich das Kreiszentrum, wo man mich willkommen heißen sollte. Der Empfang wurde allerdings durch ein trauriges Ereignis getrübt. Der Abteilungsleiter „meiner“ Sowchose, der zu einer Beratung nach Tjomkino gekommen war, sollte mich auf dem Rückweg zur Sowchose mitnehmen. Er hatte sein Pferd vor dem Gebäude der Kreisverwaltung angebunden. Doch während der Beratung fiel das Pferd in eine tiefe Wassergrube (das war im September) und ertrank. Jede Hilfe kam zu spät, und obwohl man alle Anstrengungen unternahm, konnte das Pferd nicht gerettet werden. Deshalb waren der Verwalter und ich gezwungen, zu Fuß bis zum Hauptgebäude der Sowchose zu gehen, d. h. ungefähr vier Kilometer. Mein Begleiter war sehr verstimmt – natürlich tat es ihm um das Pferd leid, doch gleichzeitig sah er die Unannehmlichkeiten voraus und war ihm deshalb böse. Wie konnte es ihm das nur antun! Ich versuchte ihn zu beruhigen und sagte, man könne unmöglich dem Pferd die Schuld für das Geschehene geben, dessen Tod gehe doch zu Lasten der Verantwortlichen der Kreisverwaltung, die für den Straßenbau zuständig seien. Leider fand dieser vernünftige Gedanke keinen Eingang in die offizielle „Fallakte“, die ich später zu unterschreiben hatte.
3. Empfang in der Sowchose
In der Geschäftsstelle der Sowchose empfing mich Direktor Michail Jakowlewitsch, ein etwas älterer Mann mit schönen grauen Haaren und einer heiseren, belegten Stimme. Viele Jahre war er in dieser Sowchose beschäftigt. Wir sprachen über Verschiedenes, natürlich auch über meine zukünftige Arbeit. Da es schon spät geworden war, empfahl mir der Direktor, ich solle mich von der Reise erholen und schlug mir vor, das Haus der Eheleute W. aufzusuchen, die sich bereiterklärt hatten, mich für eine gewisse Zeit aufzunehmen. Weil ich noch ungute Erinnerungen an eine Unterkunft während meines Diplom-Praktikums hatte, erkundigte ich mich genauer nach der Familie und bemühte mich, dabei gelassen zu bleiben. „Das sind sehr anständige und ruhige Leute, Rentner. Der Wirt ist Kriegsinvalide, interessiert sich für Bienenzucht.“ Rentner und und dazu noch Invalide – das beruhigte mich, und in Begleitung eines Büroangestellten begab ich mich zu dieser Adresse. Um es gleich vorwegzunehmen, meine Gastgeber erwiesen sich wirklich als sehr angenehme und sympathische Menschen. Ich wohnte einige Monate bei ihnen, bis unvorhergesehene Umstände mich dazu veranlassten, ihr gastfreundliches Haus zu verlassen und in eine andere Wohnung zu ziehen.
4. Ich bekam einen Hund
Und das geschah so: ich träumte schon immer von einem Hund. Doch in einer Zweizimmer-Kommunalwohnung, wo außer uns noch eine Nachbarin mit ihrer erwachsenen Tochter lebte, war daran natürlich nicht denken. Ich war jedoch entschlossen, mir unbedingt einen Hund anzuschaffen, wenn ich erst mal arbeiten und selbstständig wohnen würde. In meinem ersten Urlaub fuhr ich nach Moskau, wo ich meinen Bekannten, einen großen Hundespezialisten, traf. Mit ihm zusammen begaben wir uns in das Zuchtzentrum „Roter Stern“ bei Moskau. Dort war man dabei, eine neue Rasse von Diensthunden für die Sowjetarmee zu züchten. Als Ausgangsrasse dienten Rottweiler – riesige, massive Hunde, sehr stark und klug, jedoch oft eigensinnig und schwer dressierbar. Diese Mängel hoffte man durch Kreuzung mit den Dobermann-Pinschern zu überwinden. Das sind hochgewachsene, furchtlose Hunde mit blitzartigem Reaktionsvermögen, die sich problemlos dressieren lassen. Man bot uns einige Welpen an, von denen ich den größten aussuchte und in die Sowchose brachte. Sein Name stand in meinem Kopf eigentlich schon lange fest: er sollte „Benny“ heißen, denn eine meiner Leidenschaften war damals der Jazz, und ich vergötterte den „König des Swing“, den bekannten amerikanischen Klarinettisten Benny Goodman.
Meine Gastgeber nahmen den jungen Hund äußerlich gelassen auf, ohne besondere Freude zu zeigen. Benny erwies sich als ein sehr ordentliches Wesen, er kannte den ihm zugewiesenen kleinen Teppich und erlernte schnell die grundlegenden hygienischen Regeln. Mit anderen Worten, er hinterließ im Hause keine unangenehmen Spuren. Mit der Ernährung gab es keine Probleme, denn Fleisch und Innereien gab es in der Sowchose reichlich und zudem zu erträglichen Preisen. Benny wuchs binnen Kurzem zu einem stattlichen Hund heran. Die Spaziergänge und der Umgang mit ihm bereiteten mir großes Vergnügen.
5. Die Katastrophe
Im Allgemeinen hatte ich mit Benny keine großen Probleme. Bald jedoch hatten meine Gastgeber welche, besonders , wenn ich auf Dienstreise war. An ein festes Tagesregime gewöhnt, forderte Benny auch dessen Einhaltung. Das Hauptproblem waren die Spaziergänge. Mein Wirt – dazu noch mit Gehhilfen – war er körperlich nicht in der Lage, mit Benny spazieren zu gehen. Den großen Hund bei den Spaziergängen zu bändigen, das fiel auch seiner Frau immer schwerer. Und einmal, als ich wieder auf einer Dienstreise war und Benny seinen Auslauf vermisste, äußerte er seinen entschiedenen Protest. Er drang in den Dachboden ein, wo der Hausherr viele Jahrgänge seiner gebundenen Bienenzucht-Zeitschriften und Bücher aufbewahrte, und zerriss sie in kleine Fetzen. Nach meiner Rückkehr traf ich auf einen völlig aufgelösten, schluchzenden Hausherrn, den seine Frau vergeblich zu beruhigen suchte. Obwohl man mir anfangs keinerlei Vorwürfe machte, war mir klar, dass dies für mich und Benny nicht gut ausgehen würde. Ich sollte Recht behalten, denn sehr bald folgte das Ultimatum: ein weiterer Verbleib wurde für Benny kategorisch abgelehnt. Es blieb mir nichts anderes übrig, als meinen Bruder in Moskau anzurufen und ihm zu sagen, dass ich umgehend seine Hilfe brauchte. Am übernächsten Tag kam er und nahm Benny mit. Die Abschiedsszene mit Benny zu beschreiben, erspare ich mir – sich von seinen nächsten Freunden zu trennen, das ist immer sehr schwer. Nach einigen Tagen teilte mir mein Bruder mit, dass er Benny seinem Bekannten übergeben habe. Der sei Besitzer einer großen Datscha, und der Hund gefalle ihm sehr gut. Der Gedanke, dass Benny gut untergebracht sei, beruhigte mich etwas, obwohl eine traurige Spur von dieser Geschichte in meiner Seele zurückblieb. Übrigens ging es dem Hausherrn, der die ihm zugefügte Grausamkeit nicht vergessen konnte, ebenso. Er erklärte mir, dass auch ich mir eine neue Wohnung suchen solle, denn meine Anwesenheit erinnere ihn ständig an das schreckliche Bild seiner vernichteten Bibliothek.
6. Die neue Wohnung
Es blieb mir nichts anderes übrig, als zu Michail Jakowlewitsch zu gehen und ihm die Situation zu erklären. Er wiegte den Kopf hin und her und fragte nur: „Den Hund hast du wirklich von einer Armee-Hundezuchtstation?“ Als ich dies bejahte, nickte er verständnisvoll mit dem Kopf: „Na, dann ist alles klar. Dort bringen sie den Hunden von Geburt an Ordnung bei, und wenn die Regeln verletzt werden, reagiert man streng. Dein Hund war vergleichsweise noch human – er hat nur Bücher und Zeitschriften zerrissen. Gott sei Dank, dass die Rentner selber heil geblieben sind.“ Er dachte kurz nach und hatte eine Lösung gefunden: „Demnächst übergeben wir zur Nutzung ein Haus mit zwei Wohnungen. Eine bekommst du. Aber unter der Bedingung“ – und er schaute mich streng an – „dass du keinen Hund mehr anschleppst!“
Ich bezog die neue Wohnung Ende Januar, als starker Frost herrschte. Man musste eigentlich jeden Tag den Ofen heizen und Essen kochen. Aber ich war sehr oft unterwegs. Wenn ich nach Hause kam, ging ich bei unserem Dorfladen vorbei, der nicht gerade durch ein großes Angebot glänzte. Deshalb bestand meine Ernährung in dieser Zeit aus Gebäck, Pfefferkuchen und Fischkonserven „Hering in Tomatensoße“ . Um nicht zu erfrieren, kaufte ich mir manchmal eine Flasche Wein im Dorfladen, und wenn es keinen gab, nahm ich eine Flasche von dem giftig-grünen Likör „Benedktiner“. Den gab es immer, weil er teuer war und außerdem fürchteten die hiesigen Dorfbewohner ihn aus irgendeinem Grunde.
Allerdings verwöhnten mich manchmal die barmherzigen Mitarbeiterinnen der Molkerei, wohin ich regelmäßig fuhr, um den Fettgehalt der von uns dorthin gelieferten Milch zu überprüfen. Sobald sie mich erblickten, hatten die Frauen schon ein großes Glas Sahne eingegossen. Anfangs versuchte ich abzulehnen. Doch sie besänftigten mich und sagten: „Keine Angst, trink ruhig! Sonst fällst du uns noch vom Stengel!“ Im Ganzen gesehen hatte mein Leben auf dem Lande durchaus seine Vor- und Nachteile.
7. Die Kommission aus der Gebietshauptstadt
Es war wohl Mitte März, als in die Sowchose eine große Kommission aus der Gebietshauptstadt kam. Zu ihrem Empfang nahmen alle Spezialisten mit dem Direktor an der Spitze Aufstellung vor dem Verwaltungsgebäude. Zwei Geländewagen „Gasik“ fuhren heran, die Kommissionsmitglieder mit ihrem Leiter, dem Sekretär der Partei-Gebietsleitung für Landwirtschaft, stiegen aus – und unser Direktor begann den Gästen der Reihe nach die Spezialisten der Sowchose vorzustellen. Als ich dran war, stutzten die Kommissionsmitglieder. Der Sekretär und seine Begleitung richteten den Blick überrascht auf mich. In der Tat, ich unterschied mich äußerlich ziemlich deutlich von meinen Kollegen. Erstens betraf das mein Alter – ich war der Allerjüngste. Doch der Hauptunterschied bestand, glaube ich, in meiner Ausrüstung. Alle Spezialisten waren in Pelzjacken, wattierte Hosen und Filzstiefel gekleidet, trugen Pelzmützen mit Ohrenklappen. Ich hatte einen kurzen gefütterten Mantel und gewöhnliche Wollhosen an und trug Schnürschuhe. Doch ich besaß auch eine Fellmütze – echtes Kaninchenfell. „Wie ist das zu verstehen?“ wandte sich der Sekretär fragend an den Direktor, wobei er seine dichten Augenbrauen zusammenzog. Der Direktor verstand, dass die Obrigkeit unzufrieden war und beeilte sich zu erklären: „Diesen Studenten hat man uns aus Moskau geschickt, er arbeitet bei uns als Tierzüchter. Er hat sich bisher einfach noch nicht von seinen städtischen Asphalt-Gewohnheiten trennen können.“ – „Wo hast du deinen Abschluss gemacht?“ wandte sich der Sekretär an mich. „ An der Timirjasew-Akademie“, antwortete ich bescheiden. „Und in diesem Winter hast du also bei uns gearbeitet?“ Ich bejahte seine Frage. „Na, dann hast du sozusagen eine zweite Akademie absolviert.“ * Nun wandte er sich erneut an den Direktor und fragte ihn: „Sag mal, Michail Jakowljewitsch, willst du auf deine alten Tage im Knast landen? Wenn dieser ,Student' sich was abfriert oder, Gott behüte, vor Hunger das Zeitliche segnet, dann kommst du todsicher hinter Schloss und Riegel. Also, ruf sofort den Chef der Kreis-Miliz an und sag' ihm, dass ich befohlen habe, den ,Studenten' umgehend einzukleiden. Er soll ihm eine Miliz-Winteruniform herausgeben – er hat genug davon. Und was die Ernährung angeht, so finde jemanden, der ihn ordentlich aufpäppelt. Denn wenn ihm etwas zustößt, dann kann dich niemand retten, nicht einmal das humanste Gericht der Welt, das sowjetische!“ scherzte er mit finsterem Blick.
8. Begegnung mit Major Konjuchow
Am nächsten Tag, nach der morgendlichen Arbeitsbesprechung, nahm mich der Direktor in seinem „Gasik“ mit nach Tjomkino und setzte mich am Gebäude der Kreis-Miliz ab. Das Gebäude befand sich mitten im Zentrum der Siedlung – es war ein Flachbau mit einer großen Freitreppe zur Straße hin. Auf dieser Treppe empfing uns der Milizchef, Major Konjuchow, persönlich – ein stämmiger Mann mittleren Alters mit rosigen Wangen. Soweit ich mich erinnere, hatte er immer ein Lächeln auf den Lippen. Ich kannte ihn bereits von früheren Begegnungen, denn er kam manchmal aus verschiedenen Gründen zu uns in die Sowchose. Nach der Begrüßung wiegte er gewöhnlich heuchlerisch seinen Kopf und sagte: „Na, junger Mann, du verletzt unsere Gesetze. Ein sowjetischer Bürger darf nicht ohne Anmeldung eine Wohnung beziehen! Nimm dir etwas Zeit und komm zu mir, dann werden wir das unbedingt in Ordnung bringen.“ Meist redete ich mich mit einem Witz heraus und sagte, dass ich leider zur Zeit sehr beschäftigt sei.
Diesmal kam er nicht auf sein Lieblingsthema zu sprechen. Er sagte: „Also, wir müssen dich retten, sonst kann es passieren, dass du uns erfrierst. Na gut, wenn nötig, dann retten wir dich eben, aber danach – und er drohte mir scherzhaft mit dem Finger – machen wir trotzdem deine Anmeldung.“ – Wir gingen in sein Büro, er musterte mich mit professionellem Blick und befahl dem Diensthabenden, vom Lager eine Winteruniform der erforderlichen Größe zu bringen. Diese bestand aus einer schwarzen Pelzjacke mit hellblauem Kragen, dunkelblauen wattierten Hosen, schwarzen Filzstiefeln mit Galoschen und braunen Handschuhen. Die Pelzmütze mit Ohrenklappen, verziert mit einer Milizkokarde, lehnte ich vernünftigerweise ab – ich war mit meinem „Kaninchenfell“ voll und ganz zufrieden.
Ich dankte dem Major für das großzügige Geschenk – und wir gingen auf die Treppe hinaus, um auf den Direktor zu warten, der versprochen hatte, nach einer halben Stunde zurück zu sein. An einen Pfahl bei der Treppe war eine gesattelte, hochgewachsene, rothaarige Stute angebunden, der man offensichtlich ihre Verwandtschaft mit der englischen Pferderasse ansah. Als das Pferd uns erblickte, spitzte es die Ohren, wandte uns den Kopf zu und wieherte leicht. „Das ist meine Brusnitschka“, sagte der Major und streichelte den langen schlanken Hals des Pferdes. Dann reichte er ihr auf der Handfläche ein Zuckerstück. Brusnitschka nahm vorsichtig den Zucker, ihn kaum mit den Lippen berührend, und bedankte sich mit einem Kopfschütteln. Ich muss sagen, dass ich mich des öfteren davon überzeugen konnte, dass der Major seinen Namen Konjuchow ganz und gar rechtfertigte („Konjuch“ heißt auf Russisch „Pferdewart“ – Anm. des Übers.). Er war in der Tat ein großer Pferdekenner und -liebhaber. Doch davon später.
9. Es fand sich eine Familie für mich
„Na, eines deiner Probleme hätten wir also gelöst“, sagte der Direktor, als wir wieder aus der Kreisstadt in der Sowchose eintrafen. „Jetzt lass uns überlegen, wie wir die Sache mit deiner Ernährung in Ordnung bringen. Ich habe schon eine Idee. In den nächsten Tagen soll eine Familie aus Weißrussland in unsere Sowchose übersiedeln. Der Mann hat irgendein Technikum absolviert und möchte gern in der Viehzucht arbeiten. Er verfügt über Berufserfahrung und ich will ihn als Brigadier in der Milchfarm einsetzen. Die Frau hat bisher nicht die Absicht zu arbeiten – sie will sich der Hauswirtschaft und Kindererziehung widmen. In unserer Filiale werden gegenwärtig finnische Häuschen für Übersiedler gebaut – und eins wird in den nächsten Tagen fertig. Es befindet sich direkt gegenüber dem Verwaltungsbüro. Da wirst du einziehen. Du bekommst das Eckzimmer. Und in den beiden anderen, etwas größeren, wird die zugezogene Familie unterkommen. Das Oberhaupt der Familie ist dir bei der Arbeit untergeordnet – so kannst du, wenn du willst, alle Fragen gleich zu Hause klären. Mit der Hausfrau wirst du dich einigen, dass sie für dich kocht und, wenn nötig, die Wäsche wäscht. Sie sagt bestimmt nicht nein. Du hast ein gutes Gehalt – also, das schaffst du. Dafür wirst du wie ein normaler Mensch leben.“
Auf diese Weise waren meine Alltagsprobleme geklärt. Das Oberhaupt der Familie, Wasilij Alexejewitsch, war 10 Jahre älter als ich, er erwies sich als ruhiger und lebenserfahrener Mensch. Wie übrigens auch seine Ehefrau Sina. Sie war sofort mit allen meinen Bitten einverstanden, und es gab niemals irgendwelche Probleme damit. Ihre beiden kleinen Töchter, ungefähr 3 und 5 Jahre alt, hatten blonde Haare, waren fröhlich und wissbegierig. Sie trugen sehr zu einer Atmosphäre häuslicher Gemütlichkeit bei. Ich wohnte in diesem Haus fast drei Jahre – bis zur Beendigung meiner Arbeit in der Sowchose. Ich bin dieser Familie sehr dankbar. Und auch meinem Direktor, einem einfühlsamen Kenner der menschlichen Psychologie. Er besaß außerdem die Gabe der Vorhersehung: ich begann in der Tat wie ein Mensch zu leben.
10. Der Bevollmächtigte aus Smolensk
Der Sommer kam, eine schwierige Winter- und Frühlingszeit lag hinter uns, die Aussaat war in vollem Gange, die Tiere wurden auf die Weide getrieben. Und die verschiedenen Kommissionen aus der Kreis- und Gebietsverwaltung waren ständig bei uns zu Gast. Früher „verwöhnten“ sie uns nicht so oft mit ihren Besuchen. Die Kommissionen, die sich für Fragen der Tierzucht interessierten, trafen sich in der Regel mit dem Direktor und mir. Ich hatte damals den Posten eines Leitenden Spezialisten. Danach fuhren wir mit ihnen durch die Filialen der Sowchose, die Auswertung fand dann wieder in der Zentrale statt. Gewöhnlich gab es noch ein Essen, das entweder im Haus des Direktors oder bei mir stattfand. Wegen meiner bescheidenen Wohnbedingungen konnte ich allerdings nur eine Person oder maximal zwei zum Essen empfangen.
Einmal, im späten Herbst, kam ein Vertreter der Smolensker Gebietsverwaltung, um die Planerfüllung der Sowchose bezüglich Milch und Fleisch zu überprüfen. Es handelte sich um einen sympathischen jungen Mann, nennen wir ihn Igor. Wir trafen uns im Verwaltungsbüro der Sowchose und dann fuhr ich mit ihm auf einem „Gasik“ zu den Filialen und in einige Farmen. Besondere Fragen stellte der Kontrolleur nicht und so kehrten wir schnell zum Hauptgebäude zurück, um uns mit dem Direktor zu treffen. Doch aus irgendeinem Grund war er nicht anwesend, und so lud ich Igor zu mir ein. Ich hatte Sina vorher schon instruiert, dass wir möglicherweise einen Gast haben würden. Daher empfing uns, als wir in das Haus traten, der appetitliche Geruch einer ukrainischen Borschtschsuppe. Sina ging zum Kühlschrank und blickte mich fragend an. Ich nickte unauffällig, und bald stand auf dem Tisch eine gut gekühlte Flasche „Stolitschnaja-Wodka“ - aus unangetasteten Vorräten. (Meist wurde, wenn nötig, das Produkt aus häuslicher Produktion genutzt. Den Rohstoff dafür, rote Bete, besorgte der Hausherr. In der Qualität stand unser „Produkt“ dem normalen „Stolitschnaja“ keineswegs nach. Trotz aller Bemühungen bewahrte es jedoch eine fliederfarbene Tönung, weswegen wir uns nicht entschließen konnten, dieses Getränk Gästen anzubieten.)
Das Essen verlief, wie man so sagt, in einer angenehmen, freundlichen Atmosphäre. Sina bot uns immer wieder Borschtsch an und war beleidigt, als wir sagten, dass wir schon satt seien. „Ziert euch nicht, esst!“ bat Sina beharrlich. „Den Rest geben wir ohnehin den Ferkeln.“ Ihre Töchter nahmen auch am Gespräch teil. Besonders gern erzählte die jüngere dem Gast von den letzten Neuigkeiten: „ Wir haben zwei Waskas zu Haus – Papa und unser Ferkel. Ja, und Papa hat gestern einen lebenden Fuchs gesehen und beinahe hätte er ihn sogar gefangen.“ (In Russland nennt man die Ferkel oft „Waska“, Kurzform von Wassilij – Anm. des Übers.)
Bald waren Igor und ich per Du. Nachdem wir gegessen hatten, gingen wir in mein Zimmer hinüber. Als Igor erfuhr, dass ich früher Pferdesport betrieben und an Wettkämpfen teilgenommen hatte, ja oft auf einer Moskauer Pferderennbahn gewesen war, begegnete er mir mit besonderer Achtung, die häufig Menschen verbindet, die es mit Pferden zu tun haben. Es stellte sich heraus, dass Igor ständig im Smolensker Gestüt tätig ist und dass wir außerdem beide verwandte Seelen waren. „ Weißt du was“, sagte er beim Abschied, „ich schicke dir aus unserer Zucht einen tollen Traber. Er soll bald ausrangiert werden, aber noch vor ein paar Jahren lief er die 1600 Meter in weniger als 2 Minuten und 10 Sekunden. Ich schicke ihn dir, du wirst schon sehen!“ Schließlich gingen wir als Freunde auseinander. Doch ich war so sehr mit anderen Dingen beschäftigt, dass ich Igors Versprechen bald vergessen hatte.
11. Ein Geschenk
Nach einiger Zeit traf in der Zentrale der Sowchose ein Brief aus dem Smolensker Gestüt ein. Da der Inhalt einen Bezug zur Tierzucht hatte, landete er bei mir. Auf einem an den Sowchose-Direktor adressierten Kopfbogen war ungefähr Folgendes zu lesen: „In Übereinstimmung mit dem Plan, die Qualität des Pferdebestandes des Smolensker Gebietes zu verbessern, wird Ihrem Wirtschaftsbetrieb ein Zuchthengst der russischen Traberrasse übereignet. Name: Bubentschik, Geburtsjahr: …, Inventar-Nr.: … Für den Transport sind umgehend zwei im Umgang mit Pferden erfahrene Arbeiter zu uns zu schicken...“ Ich zeigte den Brief dem Direktor. Der sagte: „Na, was schon – das Pferd ist, wie ich vermute, für dich. Deshalb kümmere du dich selbst darum. Ich habe jetzt dafür keine Zeit.“
Als alle anstehenden Probleme gelöst waren, wartete ich schon mit Ungeduld auf das versprochene Geschenk. Ungefähr nach einer Woche – es war am Ende der morgendlichen Arbeitsbesprechung – lächelte der Leiter der Hauptabteilung geheimnisvoll und forderte mich auf, mit ihm zum Pferdestall zu gehen. Ich erriet natürlich, worum es ging, doch ich bemühte mich, den Anschein zu erwecken, dass ich keinerlei Ahnung hätte. Als wir in den Pferdestall kamen, war das Erste, was mir in die Augen fiel, eine neue Box aus Holz, ungefähr 3 mal 3 Meter groß, die Wände 1,5 Meter hoch. Diese Box war die einzige im ganzen Stall. Die anderen Pferde waren in Verschlägen untergebracht und voneinander nur durch ein-zwei dünne Stangen abgetrennt.
Auf dem Boden der Box waren reichlich frisches Sägemehl und Holzspäne ausgestreut. Ein wunderschöner Rappe lief nervös von einer Ecke zur anderen. Es war ein Hengst mit einem feinen, rassigen Kopf, großen ausdrucksvollen Augen, schlankem Hals und einem länglichen Rumpf, ganz typisch für einen Traber. Genauso hatte ich ihn mir vorgestellt. Als wir uns ihm näherten, kam Bubentschik – um den handelte es sich nämlich – zu den Stangen an der vorderen Box-Wand und versuchte uns mit den Lippen zu erreichen. Es traten noch einige Arbeiter, die sich in der Nähe befanden, hinzu. Auch sie konnten ihre Begeisterung für Bubentschik nicht verbergen. Aus irgendeinem Grund erinnerte ich mich an Szenen aus dem Kinderfilm vom „Buckligen Pferdchen“. Als die Brüder von Iwanuschka, dem Narren, die ihm geschenkten Pferde mit den Goldmähnen erblickten, setzten sie sich voller Erstaunen hin, rieben sich die Augen und glaubten, es sei ein Traum.
12. Mein Freund Bubentschik
 Jetzt musste überlegt werden, wie man Bubentschik einsetzen konnte [einspannen]. Weil der Winter bereits nahte, fertigte ich eine Skizze für eine leichten Schlitten mit Doppelsitz an und gab sie an unsere Werkstätten weiter. Einen Teil des Pferdegeschirrs für Bubentschik hatten die Arbeiter, die ihn in Smolensk abgeholt hatten, mitgebracht. So war es vorher mit Igor abgesprochen worden! Die fehlenden Geschirrteile stellten geschickte Leute aus der Sowchose her. Bei uns fiel der Schnee gewöhnlich zeitig, und so spannte man die Pferde bereits im November an die Schlitten an. Als der Schlitten für Bubentschik fertig war, brachte der Pferdewart ihn zur Zentrale der Sowchose. Das war ein unvergesslicher Moment. Alle Büroangestellten kamen auf die Straße, um das neue Pferd zu bewundern. Und mit gespielter Gelassenheit kam ich aus dem Büro heraus und sagte, ich müsse unbedingt gleich zur Nachbar-Filiale fahren. Ich setzte mich in den Schlitten und zog die Zügel leicht an. Bubentschik, der spürte, dass alle Blicke auf ihn gerichtet waren, lief mit stolz erhobenem Haupt, langsamen Schritts und leicht schnaubend am Bürogebäude entlang. Dann setzte er sich in Trab, und als das Dorf bereits hinter uns lag, eilte er in gestrecktem Tempo dahin. Seitdem fuhr ich praktisch nicht mehr mit meinem „Gasik“.
Jetzt musste überlegt werden, wie man Bubentschik einsetzen konnte [einspannen]. Weil der Winter bereits nahte, fertigte ich eine Skizze für eine leichten Schlitten mit Doppelsitz an und gab sie an unsere Werkstätten weiter. Einen Teil des Pferdegeschirrs für Bubentschik hatten die Arbeiter, die ihn in Smolensk abgeholt hatten, mitgebracht. So war es vorher mit Igor abgesprochen worden! Die fehlenden Geschirrteile stellten geschickte Leute aus der Sowchose her. Bei uns fiel der Schnee gewöhnlich zeitig, und so spannte man die Pferde bereits im November an die Schlitten an. Als der Schlitten für Bubentschik fertig war, brachte der Pferdewart ihn zur Zentrale der Sowchose. Das war ein unvergesslicher Moment. Alle Büroangestellten kamen auf die Straße, um das neue Pferd zu bewundern. Und mit gespielter Gelassenheit kam ich aus dem Büro heraus und sagte, ich müsse unbedingt gleich zur Nachbar-Filiale fahren. Ich setzte mich in den Schlitten und zog die Zügel leicht an. Bubentschik, der spürte, dass alle Blicke auf ihn gerichtet waren, lief mit stolz erhobenem Haupt, langsamen Schritts und leicht schnaubend am Bürogebäude entlang. Dann setzte er sich in Trab, und als das Dorf bereits hinter uns lag, eilte er in gestrecktem Tempo dahin. Seitdem fuhr ich praktisch nicht mehr mit meinem „Gasik“.
Bubentschik war ein ausgesprochen kluges Pferd. Das stellte er in ganz verschiedenen Situationen unter Beweis. Manchmal schien es mir, als ob er bei unsere Fahrten ein ebenso großes Vergnügen hatte wie ich, was man durchaus verstehen konnte. Fast alle, die ihn bei unseren Schlittenfahrten sahen, blieben stehen und schauten ihm noch lange hinterher. Es schien, als ob er die allgemeine Begeisterung spürte und darauf mit stolz erhobenem Haupt, einem fröhlichem Schnauben reagierte oder gar mit lautem Wiehern grüßte. Unsere Sowchose war eine der größten im Gebiet. Die Fläche betrug mehr als 20 000 Hektar und es gab Entfernungen zwischen den Sowchose-Abteilungen – bis zu 17 km. Im Territorium gab es zwei Flüsse: die Ugra und die Worja, die im Winter zugefroren waren. So konnten Bubentschik und ich uns erst richtig entfalten. Manchmal stieß ich in einer weit entfernten Filiale der Sowchose auf eine Kommission, die gerade auf dem Weg zur Zentrale war. Sie boten mir an, ich solle, um Zeit zu sparen, in ihr Auto umsteigen. Das Pferd könne einer der Arbeiter später zum Stall bringen. Ich weigerte mich ganz entschieden, stritt mit ihnen und meinte, dass ich das Zentralbüro eher als sie erreichen würde. In der Regel wurde mir empfohlen, lieber nicht zu streiten und unnütz Zeit damit zu vergeuden. Als Antwort berührte ich den Rücken des Pferdes leicht mit dem Zügel. Und in derselben Sekunde streckte sich Bubentschik und schnellte los. Plötzlich verschwanden die Bäume am Straßenrand, denn sie verwandelten sich in ein ununterbrochenes grau-grünes Band. Die frische Luft wehte mir ins Gesicht. Bubentschik flog wie ein Pfeil nach Hause und ließ eine Wolke von Schneegestöber hinter sich zurück. Es kam niemals vor, dass ich später als die Kommission dort eintraf.
13. Die Drohung des Majors Konjuchow
Nach einigen Monaten hatte ich Bubentschik sehr liebgewonnen. Und mir schien, dass auch er eine besondere Zuneigung zu mir verspürte. Kurz gesagt, wir begannen uns einander zu verstehen. Doch bald wurden unsere Beziehungen bedroht: denn der Milizchef Konjuchow fand großes Gefallen an Bubentschik.
Bedingt durch meine Arbeit musste ich – wie früher schon oft – in verschiedene Städte des Smolensker Gebiets fahren. Um diese Ziele zu erreichen, war man meist gezwungen, über die Stadt Wjasma zu reisen, und das kostete, wenn man den Zug nahm, viel Zeit, obwohl die Entfernung bis dorthin nicht sehr groß war. Daher hatte die Obrigkeit den Einfall, in der Nähe unserer Kreisstadt einen Flugplatz zu bauen. Hier kamen als Flugzeugtypen die Antonow AN-2 (auch „Kukurusniki“, d.h. „Maisflieger“ genannt). Die Fahrt nach Wjasma verkürzte sich auf insgesamt 20-30 Minuten.
Zum Flugzeug brachte mich gewöhnlich unser Pferdewart mit Bubentschik: im Winter im Schlitten, im Sommer in einer Kalesche. Um zum Flugplatz zu gelangen, mussten wir die ganze Siedlung Tjomkino durchqueren, da sich das Flugfeld hinter der Ortschaft befand. Wenn wir an der Kreismiliz vorbeifuhren, verfiel Bubentschik in einen schön anzuschauenden Paradetrab, wobei er verächtlich zu schnauben anfing. Es war, als ob er fühlte, dass mein Verhältnis zur Miliz wegen ihm nicht das beste war. In diesem Moment kam Major Konjuchow auf die Treppe heraus und drohte mir mit dem Finger. Ich wusste, was diese Geste zu bedeuten hatte: „Wenn du mir das Pferd nicht gibst, dann bekommst du Probleme wegen der polizeilichen Anmeldung.
Bubentschik hatte sofort das Herz des Majors erobert. Seitdem das Pferd bei mir auftauchte, hatte der Major ein Auge auf ihn geworfen und, immer, wenn er mich traf, versuchte er an mein Gewissen zu appellieren und sagte: „Hör zu, ich habe dich mit Kleidung und Schuhwerk ausgestattet, man kann sagen, ich habe dich vor dem Tod gerettet. Und du gönnst mir nicht einmal irgend so ein Pferd?“ Ich entgegnete: „Erstens, ist das nicht ,irgend so ein Pferd' – das ist, um es mit eurer Sprache auszudrücken, mein Partner, mit dem wir zusammen arbeiten. Und was meine Meldepflicht angeht, Genosse Major, so ist das überhaupt kein Grund zur Beunruhigung für Sie, weil unsere Gegend hier bekanntermaßen nicht der Meldepflicht unterliegt.“ „Du hast nicht recht“, parierte der Milizchef, „weil dies nur diejenigen betrifft, die sowieso über keinen Pass verfügen. Aber du hast einen, und deshalb muss ich dich anmelden, was ich auch mit dem größten Vergnügen tun werde, falls du keine Vernunft annimmst.“ - „Es tut mir leid, Genosse Major, doch aus Ihnen spricht jetzt leider ein ausgesprochen egoistisches Interesse. Sie vergessen, dass Bubentschik uns zur Erfüllung einer wichtigen staatlichen Aufgabe zugeteilt wurde. Er soll nämlich die Qualität unseres Pferdebestandes verbessern, zur Zeit sind in der Sowchose ansonsten nur Schindmähren übriggeblieben. Im Gegensatz dazu haben Sie bei der Miliz meist Pferde wie ausgesucht. Allein Ihre Brusnitschka ist ein gutes Beispiel!“ Kurz gesagt, unsere Diskussion führte zu keinem konkreten Ergebnis.
14. Die letzte Bitte von Major Konjuchow: Rette Brusnitschka!
Eines Morgens, Ende 1963, klingelte bei mir im Büro das Telefon. Ich hörte die aufgeregte Stimme des Majors, er bat mich umgehend zu ihm zu kommen. Es sei gesagt, dass wir ungeachtet unserer Meinungsverschiedenheiten im Ganzen gesehen gute, ja ich würde sogar sagen, freundschaftliche Beziehungen hatten. Er war ein gutherziger und scharfsinniger Mensch, außerdem verband uns eine gemeinsame Leidenschaft für Pferde.
Als ich in der Kreismiliz ankam, begab ich mich sofort ins Büro des Majors, den ich in einem für ihn ungewöhnlichen Zustand antraf – er war nervös und, wie mir schien, sogar aus der Fassung geraten zu sein. Er sah mich an und reichte mir irgendein Dokument. Es war die Verordnung der Gebietsverwaltung über die Zusammenlegung der Kreise im Smolensker Gebiet. Konkret bedeutete dies, dass alle Behörden unseres Kreises, einschließlich die Milizabteilung, nicht mehr existieren und in die Stadt Gshatsk umziehen sollten. Ich versuchte den Major zu beruhigen und sagte, dass die Vergrößerung der Kreisverwaltung durchaus bestimmte Vorteile haben kann – und sogar auch für ihn selbst. Als Antwort runzelte er nur die Stirn und schob mir noch ein Dokument herüber. Dabei handelte es sich um eine Anordnung für den Milizchef der Kreisabteilung Tjomkino, binnen drei Tagen alle Pferde seiner Abteilung an „Sagotskot“ (eine Vieherfassungsstelle – Anm. des Übers.) abzugeben. „Verstehst du, was das heißt?“ schrie der Major, völlig aufgebracht. „Das bedeutet, dass alle Pferde, darunter auch meine Brusnitschka, in zwei Tagen im Fleischkombinat von Wjasma landen werden, wo man sie zu Wurst verarbeitet.“ Der Major ließ sich kraftlos in den Sessel fallen und fragte: „Ist das etwa menschlich?“ Obwohl dies eine rein rhetorische Frage war und keine Antwort erforderte, verstand ich die Gefühle des Majors nur zu gut und ich schüttelte niedergeschlagen den Kopf.
Nachdem wir eine Weile geschwiegen hatten, erhob sich der Major von seinem Sessel und kam auf mich zu: „Ich habe eine große Bitte an dich. Lass uns wenigstens Brusnitschka retten!“ Ich schaute ihn ungläubig an: „Na klar! Aber wie?“ - „Ich denke, das ist nicht allzu kompliziert. Wir machen das so: du nimmst Brusnitschka zu dir. Und an ihrer Stelle lieferst du an „Sagotskot“ eine von den abgemagerten Mähren der Sowchose. Ich vermute, dass es keine Probleme nach sich ziehen wird.“ - „Na gut!“ sagte ich, „die Situation ist mir klar.“ „Auch wenn uns nicht seit langem freundschaftliche Beziehungen verbinden würden, hätte ich trotzdem so gehandelt, wie Sie es wünschen! Und selbstverständlich nicht aus persönlichem Interesse.“ Ich streckte dem Major meine Hand entgegen, die er fest drückte.
15. Brusnitschka
 Auf diese Weise kam ein zweites erstklassiges Pferd in unsere Sowchose – ein Reitpferd. Brusnitschka erwies sich vielfach für mich sogar geeigneter als Bubentschik, weil sie weder Schlitten noch Kalesche brauchte, nur einen Sportsattel, den ich als „Zugabe“ von ihrem früheren Besitzer bekam. Brusnitschka war im Umgang nicht so streng wie Bubentschik. Sie liebte es, wenn man sich mit ihr unterhielt. Ich möchte sagen: in ihrem Verhalten waren mehr weibliche Züge zu spüren – und man konnte sie mit einem zärtlichen Wort, einem Zuckerstück oder einfach mit einem Streicheln über den Hals beruhigen. Und wenn Bubentschik sozusagen mehr das „Paradepferd“ darstellte, dann war es einfach bequemer mit Brusnitschka zu den Filialen der Sowchose zu reiten, und ich fühlte mich mit ihr bei den Reitgängen ruhiger. Außerdem gefielen mir die Spazierritte mit Brusnitschka in meiner Freizeit sehr , besonders an klaren, sonnigen Tagen. Diese tankten mich mit Energie auf, stellten mein seelisches Gleichgewicht wieder her, ich fand meine innere, „philosophische“ Einstellung, die es mir erlaubte, von unangenehmen Gedanken loszukommen. Mir gefielen die abendlichen Spazierritte mit Brusnitschka – vor Sonnenuntergang, wenn der Wind sich legt und „die müde Natur sich rings schwer atmend ausbreitet“ (N. Sabolozkij). So kam es, dass mir Brusnitschka immer mehr gefiel, und ich war ihr dankbar für all das Neue, was sie in mein Leben gebracht hatte.
Auf diese Weise kam ein zweites erstklassiges Pferd in unsere Sowchose – ein Reitpferd. Brusnitschka erwies sich vielfach für mich sogar geeigneter als Bubentschik, weil sie weder Schlitten noch Kalesche brauchte, nur einen Sportsattel, den ich als „Zugabe“ von ihrem früheren Besitzer bekam. Brusnitschka war im Umgang nicht so streng wie Bubentschik. Sie liebte es, wenn man sich mit ihr unterhielt. Ich möchte sagen: in ihrem Verhalten waren mehr weibliche Züge zu spüren – und man konnte sie mit einem zärtlichen Wort, einem Zuckerstück oder einfach mit einem Streicheln über den Hals beruhigen. Und wenn Bubentschik sozusagen mehr das „Paradepferd“ darstellte, dann war es einfach bequemer mit Brusnitschka zu den Filialen der Sowchose zu reiten, und ich fühlte mich mit ihr bei den Reitgängen ruhiger. Außerdem gefielen mir die Spazierritte mit Brusnitschka in meiner Freizeit sehr , besonders an klaren, sonnigen Tagen. Diese tankten mich mit Energie auf, stellten mein seelisches Gleichgewicht wieder her, ich fand meine innere, „philosophische“ Einstellung, die es mir erlaubte, von unangenehmen Gedanken loszukommen. Mir gefielen die abendlichen Spazierritte mit Brusnitschka – vor Sonnenuntergang, wenn der Wind sich legt und „die müde Natur sich rings schwer atmend ausbreitet“ (N. Sabolozkij). So kam es, dass mir Brusnitschka immer mehr gefiel, und ich war ihr dankbar für all das Neue, was sie in mein Leben gebracht hatte.
16. Entzug meiner Moskauer Wohnungsanmeldung
Das großartigste Ereignis meines Lebens im nächsten Jahr, 1964, war die Reise mit einer Jugenddelegation in die Volksrepublik Polen, die ich in diesem Buch als nächste Erzählung „Rendezvous mit Marlene Dietrich“ beschrieben habe. Als ich aus Polen zurückgekehrt war, fuhr ich für ein paar Tage nach Moskau, um meine Verwandten zu sehen. Und dort erwartete mich eine Überraschung.
Diese Überraschung kam mit einem Brief des Leiters der Abteilung für Pass- und Meldewesen des Moskauer Timirjasew-Bezirks. Er informierte mich darüber, dass in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen meine Wohnungsanmeldung in Moskau annulliert worden sei. Gleichzeitig wurde ich aufgefordert, in der nächsten Zeit das Bezirksbüro der Miliz aufzusuchen, um die entsprechende Eintragung in meinem Inlandspass vornehmen zu lassen.
Ich beschloss, dies Sache nicht auf die lange Bank zu schieben und ohne Zögern der Aufforderung Folge zu leisten. In dem Büro, dessen Nummer im Brief genannt wurde, empfing mich fast freudig ein Milizbeamter. Er begrüßte mich, breitete theatralisch die Arme aus und sagte: „ Wie kann das sein, junger Mann, die Hochschule haben Sie absolviert, aber Sie verletzen unsere Gesetze. Wissen Sie wirklich nicht, dass man bei uns nicht ohne Anmeldung wohnen darf und dass Sie, wenn Sie einen anderen Wohnort wählen, verpflichtet sind, sich abzumelden?“ – „Natürlich weiß ich das, Genosse Oberstleutnant,“ antwortete ich munter. „Die Sache ist aber die, dass ich meine Arbeit nur für eine bestimmte Frist aufgenommen habe. Danach beabsichtige ich, nach Moskau zurückzukehren, weil ich für ein Aufbaustudium in einer Aspirantur empfohlen worden bin. Daher habe ich beschlossen, mich einstweilen nicht abzumelden, weil es später, wie man hört, Probleme mit der Wieder-Anmeldung geben könnte.“ – „Das sind alles leere Gerüchte“, beruhigte mich der Oberstleutnant, „fahren Sie ruhig zur Arbeit, nehmen Sie Ihre Aspirantur auf, und dann kommen Sie zu mir und ich werde Sie sofort ohne Probleme anmelden.“ Durch dieses Versprechen ein wenig beruhigt, verabschiedete ich mich freundlich von diesem fröhlichen Oberstleutnant.
17. Probleme mit der Aspirantur
Ein Jahr später, im Herbst 1965, bestand ich während meines Jahresurlaubs erfolgreich die Aufnahmeprüfungen für die Aspirantur an der Moskauer Timirjasew-Akademie. Ein paar Tage danach erhielt ich den Immatrikulationsbescheid zum 1. Januar 1966. Ich musste bis dahin alle meine Angelegenheiten in der Sowchose klären und die Kündigungsformalitäten erledigen. Allerdings ergaben sich unerwartet ernsthafte Probleme. Auf der ordentlichen Konferenz der Direktoren und Leitenden Spezialisten, bei der auch der Erste Sekretär der Smolensker Gebietsleitung der KPdSU, N. I. Kalmyk, anwesend war, kam jemand auf die Idee, mich für irgendeine Arbeitskommission vorzuschlagen. Es wurde im Saal die Frage laut: „Wie kann er denn in einer Kommission arbeiten, wenn er doch nach Moskau geht, um in der Aspirantur zu studieren?“ Da erhob sich plötzlich im Präsidium der Gebietsparteisekretär von seinem Platz und sagte: „Was für eine Aspirantur? Wer hat die genehmigt? Wer lässt ihn dorthin gehen?“
Die Frage wurde an den Ersten Sekretär der Gshatsker Stadtparteileitung weitergegeben. A. I. Artjuchow, der natürlich über meine Pläne Bescheid wusste, versuchte irgendwas zu erklären. Doch das brachte den Gebietssekretär erst recht in Wut. Er fing an zu schreien: „Wer gab euch das Recht, über unsere Kader zu verfügen? Ein Leitender Spezialist – der gehört nicht zu euren Kadern, sondern dies ist die Nomenklatura der Gebietsparteileitung! Kurz gesagt, er fährt nirgendwohin, lasst seinen Namen in der Liste für die Abstimmung! Und Sie, junger Mann“, wandte er sich an mich, „Kommen Sie nach Smolensk. Dort werden wir schon herausbekommen, wer wohin fährt und weshalb!“ endete er mit deutlich drohendem Unterton.
18. Die Fahrt nach Smolensk
Was blieb mir übrig? Mit bedrückten Gedanken fuhr ich nach Smolensk, denn alle meine Pläne und Hoffnungen drohten zusammenzubrechen. Bevor ich losfuhr, hatte ich ein Gespräch mit unserem Sekretär der Stadtparteileitung N. I. Artjuchow. Er zeigte Verständnis für meine Situation und riet mir, mich nicht zu ereifern und keinesfalls zu streiten. Mit der Gebietsparteileitung wird sich keine Organisation anlegen, auch nicht unsere Akademie. „Wenn es ganz schlimm kommt, dann versuche, wenigstens die Zustimmung für eine Aspirantur im Fernstudium zu bekommen“, empfahl er mir.
In Smolensk begab ich mich sofort zum Gebäude des Gebietsleitung der KPdSU. Am Eingang zeigte ich meinen Dienstauftrag, unterschrieben vom Ersten Sekretär der Gshatsker Stadtparteileitung, und fragte den Diensthabenden, wo sich das Büro von N. I. Kalmyk befinde. Der Sekretär im Vorzimmer erkundigte sich, weswegen ich den Ersten Sekretär sprechen wolle. Ich erklärte, ich sei auf seine Einladung hin gekommen. – „Er ist nicht da, er ist auf Dienstreise“, sagte der Sekretär. – „Vielleicht kann ich mit dem Zweiten Sekretär sprechen?“ – „Er ist auch nicht da. Aber um welche Frage geht es denn eigentlich?“ Ich antwortete, dass ich Leitender Spezialist einer Sowchose im Gshatsker Kreis sei. Und was meine Frage angeht, sie sei von persönlicher Art. „Dann sollten Sie sich vielleicht an den Leiter der Gebietsverwaltung für Landwirtschaft, Genossen Solowejtschik, wenden. Sie wissen, wo er zu finden ist?“ Ohne etwas zu sagen, nickte ich mit dem Kopf.
Nach einigen Minuten befand ich mich im Büro von B. A. Solowejtschik, das mir von meinem ersten Besuch in Smolensk bekannt war. In den seit damals vergangenen dreieinhalb Jahren hatte sich der Mann fast nicht verändert. Schweigend hörte er sich meine Erzählung an, sagte zunächst gar nichts und schaute aus dem Fenster. Ich schrumpfte innerlich zusammen, spürte einen Kloß im Hals und versuchte zu erraten, woran er jetzt dachte. Doch er schwieg weiter und konnte seinen Blick nicht vom Fenster losreißen. Für mich blieb die Zeit stehen. Plötzlich schien Boris Antonowitsch zu einem Entschluss gekommen zu sein. Er hatte meinen Gemütszustand wahrgenommen und drehte sich zu mir um. Dann lächelte er mir ermunternd zu und fragte: „Hast du den Antrag dabei“ Ich war kaum imstande zu antworten; ich nickte nur und reichte ihm den „Antrag zur Arbeitsfreistellung zum Zweck der Aufnahme einer Aspirantur im Direktstudium...“ Er unterschrieb schwungvoll und vermerkte das Datum. Beim Abschied lächelte er noch einmal freundlich und bat mich, im Sekretariat nicht zu vergessen, den Stempel daruntersetzen zu lassen.
In der Sowchose erledigte ich die Kündigungsformalitäten und übergab alles ordnungsgemäß meinem Stellvertreter. Ich verabschiedete mich vom Direktor und den Spezialisten, ebenso von den vielen Bekannten, die mir in diesen drei Jahren ans Herz gewachsen waren. Ich versprach ihnen, dass wir uns wiedersehen würden. Und dieses Versprechen habe ich, soweit ich konnte, auch gehalten.
19. Ablehnung meiner Neuanmeldung in Moskau
Mitte Dezember kam ich in Moskau an und bemühte sich sofort, alle erforderlichen Formalitäten zu regeln, dabei stand die Wohnungsanmeldung an erster Stelle. Ich sprach wieder in dem mir schon bekannten Büro des Leiters der Abteilung für Pass- und Meldewesen des Moskauer Timirjasew-Bezirks vor und erinnerte ihn an unsere Begegnung vor einem Jahr und an sein Versprechen, mich problemlos bei der alten Adresse anzumelden. Dem Anmeldeantrag hatte ich meinen Immatrikulationsbescheid für die Aspirantur beigefügt. Der Oberstleutnant las den Bescheid aufmerksam durch, gratulierte mir, gab ihn zurück und sagte ruhig: „Leider kann ich Sie nicht anmelden.“ Das hatte ich nicht erwartet und mir stockte der Atem. „Genosse Oberstleutnant, Sie haben es versprochen! Sie haben doch gesagt, dass es keinerlei Probleme geben würde!“ – „Bleib ruhig, reg dich nicht auf!“ versuchte mich der Oberstleutnant zu beruhigen. – „Wann habe ich dir das gesagt? Vor einem Jahr. Unser Leben ändert sich ständig – alles fließt, das wussten schon die alten Griechen. Nimm dir das nicht zu sehr zu Herzen. Noch ist nicht alles verloren. Ich schreibe jetzt die Ablehnung der Wohnungsanmeldung, dann fährst du zur Zentrale für Pass- und Meldewesen, die ist neben dem Belorussischen Bahnhof. Sprich mit ihnen, erkläre die Situation – die haben das Recht, selber zu entscheiden. Vielleicht hast du Glück. Ich wünsche dir gutes Gelingen!“
20. Das Neujahrsgeschenk
Da war wohl nichts zu machen. Ich musste zur Zentralen Pass- und Meldestelle Moskaus fahren. Sie befand sich tatsächlich nicht weit vom Belorussischen Bahnhof. Ich kam in einen großen Saal mit einer Vielzahl von Türen, die zu verschiedenen Büros führten, vor denen die Besucher saßen und hofften, dass ihre Probleme gelöst würden. Manchmal kamen Mitarbeiter in Milizuniformen aus den Zimmern, sie trugen Mappen, die Papiere enthielten. Nachdem ich herausbekommen hatte, in welches Zimmer ich gehen musste, reihte ich mich in die Warteschlange ein, die zum Glück nicht allzu groß war. Als ich das Büro betrat, saß am Schreibtisch eine junge Frau in der Milizuniform eines Majors. Ich erzählte meine Geschichte, zeigte ihr die erforderlichen Dokumente und bemühte mich, meine absurde Situation zu erklären. Man würde mir keinen Platz im Wohnheim geben, weil man ja wusste, dass ich eine Wohnung in Moskau habe. Andererseits dürfte ich diese Wohnung ohne Anmeldung auch nicht nutzen und ich könnte mich nirgendwo registrieren lassen: weder in der Poliklinik noch in der Bibliothek oder beim Wehrkreiskommando...
Die Beamtin dachte eine Weile nach und sagte dann: „Also, wir machen es so. Nach dem Gesetz kann ich Sie nur zeitlich begrenzt anmelden, d. h. für ein Jahr. Doch wir werden auch noch etwas anderes versuchen. Können Sie sich in Ihrer Akademie nicht eine Bescheinigung darüber besorgen, dass Ihre Ausbildung in der Aspirantur drei Jahre dauern wird?“ Ich sagte, das dürfte kein großes Problem sein. „Dann los! Lassen Sie mir Ihren Pass hier, und Sie fahren gleich los und bringen mir eine solche Bescheinigung. Dann könnte ich Sie nicht nur für ein, sondern für drei Jahre anmelden. Und in drei Jahren kann so viel geschehen – Sie sind doch ein junger Mann... Also, das probieren wir. Jetzt ist bei uns Mittagspause, und bis zum Ende des Arbeitstages haben Sie noch Zeit.“
Wie der Blitz sprang ich hinaus und eilte in die Kaderabteilung der Aspirantur. Glücklicherweise befand sich die Leiterin an ihrem Platz. Sie verstand sofort, worum es ging, und fertigte die geforderte Bescheinigung aus. Ich kehrte zur Pass- und Meldestelle zurück. Das Amtszimmer war verschlossen und ich musste warten, bis die Beamtin zurück war. Kurze Zeit später sah ich sie den Gang entlang laufen. Ich stürzte auf sie zu und teilte ihr voller Freude mit, dass ich die gewünschte Bescheinigung hätte. „Sehr gut!“ sagte die Majorin, „aber wissen Sie, ich habe Ihnen schon eine unbefristete Anmeldung ausstellen lassen!!!“
Mir fehlen die Worte, um das, was da passiert ist, zu kommentieren. Denn eine rationale Erklärung dafür gibt es nicht. Wir wissen sowieso nicht immer, warum dieses oder jenes mit uns geschieht. Entscheidet allein der Zufall – oder verbirgt sich hinter den Ereignissen irgendeine Gesetzmäßigkeit? Für mich selbst kam ich zu dem Schluss, dass genau dies einfach so passieren musste, gerade am Vorabend des Neuen Jahres. Das Einzige, was ich mir bis heute nicht verzeihen kann, ist, dass ich nicht sofort, als ich mit der im Pass abgestempelten unbefristeten Anmeldung in der Tasche auf der Straße stand, den nächsten Blumenladen aufgesucht und der freundlichen Frau Majorin einen großen Strauß und eine Schachtel Konfekt gebracht habe!
P.S.: Im neuen Jahr begann für mich eine andere märchenhafte Geschichte, in der sich meine geliebten Pferde in weiße Mäuse verwandelten (nicht umgekehrt – wie in dem Märchen von Charles Perrault vom Aschenputtel). Die unendlichen Felder und Wälder des Smolensker Gebiets schrumpften auf die Maße eines kleinen Moskauer Laboratoriums. Und die Ergebnisse langjähriger Arbeit würde man vielleicht nur unter dem Mikroskop sehen können, wobei diese am ehesten Spezialisten verständlich sein würden. Also, das ist in der Tat eine ganz andere Geschichte, aber sie nahm auch einen guten Ausgang. Aber darüber irgendwann ein anderes Mal!
---------------------------------------
* Es muss gesagt werden, dass die Bemerkung des Ersten Gebietssekretärs zum Teil begründet war. Für die Landwirtschaft war das damals eine ausgesprochen schwierige Zeit. Auf Vorschlag des damaligen Ersten Sekretärs des ZK der KPdSU, N. S, Chruschtschow, der sich für einen großen Spezialisten auf landwirtschaftlichem Gebiet hielt, wurde auf den besten und fruchtbarsten Bodenflächen in vielen Teilen Russlands, darunter auch im Smolensker Gebiet, vor allem Mais angebaut. Dabei berücksichtigte man nicht die natürlichen klimatischen Bedingungen und prüfte auch nicht, ob die entsprechende Infrastruktur vorhanden war. Unter den Bedingungen eines regnerischen Sommers gedieh der Mais nicht und so mangelte es an Futter bei der Viehhaltung. Besonders kompliziert waren die Folgen der „Mais-Kampagne“ im Herbst und im Winter. Die Fachkräfte und Arbeiter mussten außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen, um die Tiere zu retten (Aufbereitung von Futter auf Holzbasis, Nadelbaum-Mehl, Futter-Reiser, Erfindung von pflanzlichem Milchersatz für die Kälber u. ä.). Dennoch gelang es nicht immer, das Viehsterben zu vermeiden, besonders am Ende des Winters. Infolge dieser Landwirtschaftspolitik wurde der Tierzucht in unserem Gebiet damals erheblicher Schaden zugefügt.
Rendezvous mit Marlene Dietrich
 Im Sommer 1964 kam ich für ein paar Wochen nach Moskau, um meinen Urlaub zu Hause zu verbringen. Ich arbeitete damals als Tierzüchter in einem großen Viehzuchtbetrieb im Smolensker Gebiet, wohin ich im Herbst 1962, nachdem ich die Moskauer Timirjasew-Akademie absolviert hatte, geschickt worden war. In den ersten Urlaubstagen traf ich mich mit Freunden, besuchte mit Mutter unsere nicht gerade sehr zahlreichen Moskauer Verwandten, die die Erzählungen von meinem erlebnisreichen Landleben mit Interesse aufnahmen. Danach beschloss ich, die verbliebenen Urlaubstage dem Kulturleben der Hauptstadt zu widmen. Die Auswahl war groß – überall in der Stadt prangten bunte Plakate mit Informationen zu neuen Theaterpremieren, zahlreichen Konzerten und auch Gastspielen berühmter sowjetischer und ausländischer Künstler. Von all den Angeboten zog mich die Ankündigung eines Konzerts am meisten an, das in diesen Tagen im Moskauer Staatlichen Estradentheater an der Bersenewskaya Uferstraße stattfinden sollte. Auf dem Programm stand die weltberühmte deutsche Schauspielerin und Sängerin von Schlagern und Jazzmusik – Marlene Dietrich. Auch wenn ich den Ereignissen vorauseile, muss ich sagen, dass ihr ungewöhnliches Leben, das mit Kunst und Politik sowie vielen herausragenden Persönlichkeiten verknüpft war und in Einsamkeit endete, selbst heute, im 21. Jahrhundert, immer noch großes Interesse und Diskussionen hervorruft.
Im Sommer 1964 kam ich für ein paar Wochen nach Moskau, um meinen Urlaub zu Hause zu verbringen. Ich arbeitete damals als Tierzüchter in einem großen Viehzuchtbetrieb im Smolensker Gebiet, wohin ich im Herbst 1962, nachdem ich die Moskauer Timirjasew-Akademie absolviert hatte, geschickt worden war. In den ersten Urlaubstagen traf ich mich mit Freunden, besuchte mit Mutter unsere nicht gerade sehr zahlreichen Moskauer Verwandten, die die Erzählungen von meinem erlebnisreichen Landleben mit Interesse aufnahmen. Danach beschloss ich, die verbliebenen Urlaubstage dem Kulturleben der Hauptstadt zu widmen. Die Auswahl war groß – überall in der Stadt prangten bunte Plakate mit Informationen zu neuen Theaterpremieren, zahlreichen Konzerten und auch Gastspielen berühmter sowjetischer und ausländischer Künstler. Von all den Angeboten zog mich die Ankündigung eines Konzerts am meisten an, das in diesen Tagen im Moskauer Staatlichen Estradentheater an der Bersenewskaya Uferstraße stattfinden sollte. Auf dem Programm stand die weltberühmte deutsche Schauspielerin und Sängerin von Schlagern und Jazzmusik – Marlene Dietrich. Auch wenn ich den Ereignissen vorauseile, muss ich sagen, dass ihr ungewöhnliches Leben, das mit Kunst und Politik sowie vielen herausragenden Persönlichkeiten verknüpft war und in Einsamkeit endete, selbst heute, im 21. Jahrhundert, immer noch großes Interesse und Diskussionen hervorruft.
Natürlich konnte nur ein sehr naiver Mensch damit rechnen, eine Karte für das Konzert von Marlene Dietrich an der Theaterkasse zu erwerben. Da ich in dieser Beziehung über eine gewisse Erfahrung verfügte, versuchte ich dies erst gar nicht. Die einzig reale Möglichkeit bestand darin, ein sogenanntes „lischni biletik“ (eine übrig gebliebene Karte) zu ergattern. Deshalb verließ ich ungefähr anderthalb Stunden vor Konzertbeginn die in der Nähe des Estradentheaters gelegene Metrostation „Borowizkaya“ und lief langsam über die Große Steinerne Brücke in Richtung Theater. Auf dem Weg von der Metrostation zum Theater standen schon Hunderte von Menschen aller Altersstufen, die in die Gesichter der vorbeigehenden Leute blickten und mit einem schmeichelhaften Lächeln immer wieder dieselbe Frage stellten: „Haben Sie nicht zufällig eine Karte übrig?“ Wenn diese Frage an mich gestellt wurde, schüttelte ich verneinend den Kopf und setzte meinen Weg gelassen fort. Je näher ich dem Theater kam, desto mehr verringerte sich mein Optimismus: die Chance, glücklicher Besitzer eines „lischni biletik“ zu werden, war angesichts der großen Nachfrage eine Illusion.
Ich erreichte das Theater und stieg die breiten Stufen empor, die zu dessen Eingang führten und voller Menschen waren. Dort hielt ich inne, um durchzuatmen und mich umzuschauen. Natürlich kam mir nicht in den Sinn, auf die Glücklichen loszustürzen, die sich in ihrer Vorfreude auf die Begegnung mit der berühmten Schauspielerin auf der Treppe dem Theatereingang näherten, und ihnen die Frage zu stellen: „Haben Sie nicht eine Karte übrig?“ Entsprechend meiner längst erprobten Taktik konzentrierte ich meine Aufmerksamkeit auf diejenigen, die dastanden und auf die Uhr schauten – in der Erwartung ihrer Bekannten oder Verwandten, mit denen sie sich vermutlich hier verabredet hatten. Da fiel mein Blick auf einige Frauen, die, sagen wir mal, sich nicht gerade durch ihre Jugend und Schönheit hervortaten. Meiner Vorgehensweise lagen „tiefgründige“ psychologische Erkenntnisse zugrunde, auf die ich an dieser Stelle aber nicht näher eingehen möchte. Jedenfalls gelang es mir dadurch schon manchmal, ein begehrtes „biletik“ in meinen Besitz zu bringen. Doch diesmal funktionierte meine so gut begründete Theorie leider nicht. Zu all diesen Frauen kamen der Reihe nach Bekannte (oder Verwandte) und sie verschwanden gemeinsam hinter den Türen des Theaters. Nicht mehr als fünf Minuten blieben noch bis zum Beginn des Konzerts. Enttäuscht von meinem Misserfolg, begann ich die Treppe in Richtung Uferstraße hinabzusteigen und überlegte, was man noch unternehmen konnte, um den hoffnungslos verlorenen Abend zu retten.
Plötzlich hielt unmittelbar an der untersten Treppenstufe eine schwarze glänzend lackierte Limousine mit rotem Nummernschild (des Diplomatischen Corps – N.E.), aus der sich buchstäblich ein ganzer Haufen von Frauen und Kindern herausschob. Sie alle waren in bunte, mit Mustern bestickte Trachten gekleidet. Zusammen mit einem adretten dunkelhäutigen Mann, der ein orangefarbenes Hemd anhatte, das bis zu den Knien reichte, und einen Turban in derselben Farbe trug, begannen sie die Treppe zum Theatereingang hinaufzugehen. Ganz automatisch kramte ich meine spärlichen Englischkenntnisse hervor und fragte den Mann: „I am sorry, you do not accidentally extra ticket?“ Die Antwort kam sofort: „Yes, fortunately there is one.“ (Entschuldigen Sie, haben Sie nicht eine Eintrittskarte übrig? - Ja, glücklicherweise haben wir eine. - N. E.). Da soll mir einer sagen, dass es keine Wunder auf der Welt gäbe!
In Windeseile flog ich die Treppe hinauf ins Theater und schaffte es gerade noch, meinen Platz neben der Gruppe von Indern einzunehmen, als auch schon das Licht im Saal langsam erlosch. Nur die Bühne blieb hell erleuchtet, wo ein Conferencier im schwarzen Anzug auftrat. Er wandte sich an das Publikum und sprach nur zwei Worte: MARLENE DIETRICH!
Die Schauspielerin, eine nicht mehr ganz junge, jedoch bezaubernd aussehende, elegante und charmante Frau, erschien auf der Bühne, angetan mit einem luftigen, ihre fantastische Figur betonenden Kleid, roséfarben und von schillernden Edelsteinen besetzt. Ihre Schultern waren mit einem prächtigen Mantel aus Schwanenflaum bedeckt. Im Saal brach ein stürmischer Applaus los. Dann setzte das Orchester ein – und es erklang im halbdunklen Saal des Estradentheaters die in der ganzen Welt einem Millionenpublikum bekannte, etwas raue Stimme Marlene Dietrichs, mit dem unverkennbar ausdrucksstarken Timbre. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, erklang zu Beginn die Jazz-Interpretation des Liedes „Ich kann dir nichts außer Liebe bieten, Baby (I Can't Give You Anything But Love, Baby). Nach so vielen Jahren ist es natürlich unmöglich, sich an alle Lieder zu erinnern, die Marlene Dietrich gesungen hat. Besonders blieben mir im Gedächtnis das wunderschön interpretierte Lied „Johnny, wenn du Geburtstag hast...“, außerdem „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ und „Das Lied ist aus, frag nicht warum“, ein eher trauriger Song.
Das Konzert, das zwei Teile hatte, ging viel zu schnell zu Ende. Unter lang anhaltendem Beifall brachte man zum Abschied einen riesigen Korb mit Blumen auf die Bühne. Und die Zuschauer, ganz erfüllt und beeindruckt von der herrlichen Musik sowie der Begegnung mit der großen Schauspielerin, gingen allmählich auseinander.
Die noch verbliebenen Tage bis zum Ende des Urlaubs vergingen wie im Fluge, und so kehrte ich wieder zu meiner Arbeit in dem Viehzuchtbetrieb auf dem Land zurück. Außerhalb meiner normalen Arbeit war ich gesellschaftlich tätig – ich war Sekretär der Komsomol-Ortsgruppe. Die Arbeit mit Jugendlichen bereitete mir immer Vergnügen, und das spielte offenbar eine bestimmte Rolle, als im Herbst 1964 eine Gruppe von jungen Arbeitern für eine Freundschaftsreise in die Polnische Volksrepublik zusammengestellt wurde.
Die Sache war die, dass im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, die in der Chrustschowschen Tauwetterperiode begann, das Smolensker Gebiet und die Woiwodschaft Wrocław eine Partnerschaft eingegangen waren. Man hatte sich zum Ziel gesetzt, die Produktions- und Kulturbeziehungen zu verstärken. Für den Anfang beschloss man Jugenddelegationen auszutauschen.
Die Kandidaten für die Reise wählte man aus verschiedenen Kreisen des Gebiets aus und danach wurden diese vom Komsol-Gebietskomitee sorgfältig begutachtet. Meine Kandidatur – schließlich war ich ein junger Spezialist, ja sogar der Sekretär der Komsomol-Ortsgruppe! – wurde ebenfalls von der Kommission geprüft. Allerdings erfuhr ich bald von mir bekannten Mitarbeitern des Gebietskomitees, dass bezüglich meiner Person gewisse Komplikationen aufgetaucht seien. Mit Einzelheiten rückte man natürlich nicht heraus, doch ich konnte mir schon selbst denken, um welche Probleme oder, besser gesagt, um welchen „Punkt“ es sich vielleicht handelte. Kurze Zeit später war die gesamte Gruppe für die Reise nach Polen zusammengestellt, leider ohne meine Teilnahme. Aber etwa eine Woche vor der Abreise der Gruppe erhielt ich die Nachricht, dass ich doch noch mitfahren sollte. Ausschlaggebend war vermutlich, dass ich seit meiner Kindheit (dank meiner Kinderfrau Josefa Kasimirowna) Polnisch beherrschte. Und jemand von „da oben“ war wohl der Meinung, dass dies bei der Reise nach Polen, zu dem die Beziehungen damals nicht gerade die besten waren, eine positive Rolle spielen könnte.
Man bestellte mich nach Smolensk, und die wenigen Tage bis zur Abreise vergingen mit ständigen Treffen, Konsultationen und Anweisungen für unsere Gruppe – und dies auf verschiedensten Ebenen. Man wollte uns kennenlernen, gab Ratschläge, worüber wir sprechen könnten und worüber nicht, wie wir uns in komplizierten Situationen zu verhalten hätten, um mögliche Provokationen zu vermeiden. Da der größte Teil der Gruppe aus jungen Männern bestand, wurde insbesondere auf die medizinische Gefährlichkeit verwiesen, die sich beim Kontakt mit den verführerischen polnischen Mädchen ergeben könnten. Es wurde uns empfohlen, ständig wachsam und vorsichtig zu sein. Entschieden verboten war es, hochprozentige Getränke zu konsumieren und allein zu bleiben, etwa auf den Straßen, in Hotels, bei den verschiedenen Treffen und Veranstaltungen. Wir sollten uns mindestens zu zweit, besser noch als Gruppe bewegen. Man berichtete uns von früheren Verletzungen dieser Hinweise durch einzelne Bürger (darunter auch unserer Landsleute) und wies uns auf die harten Maßnahmen hin, die man ihnen gegenüber nach ihrer Rückkehr in die UdSSR zu ergreifen gezwungen war.
Das Abschlussgespräch mit uns fand im Gebietskomitee der KPdSU statt. Dort gab uns der Gebietssekretär den Rat, vor allem daran zu denken, dass wir Sowjetmenschen seien und überall frei, stolz und unabhängig auftreten sollten, weil wir doch eine Großmacht zu vertreten hätten. Zu guter Letzt erinnerte er nochmals an unseren Hauptauftrag, nämlich freundschaftliche Kontakte mit der polnischen Jugend herzustellen – und abschließend wünschte er uns eine interessante und erfolgreiche Reise.
Am nächsten Tag trafen wir uns mit dem Leiter unserer Gruppe, einem Mitarbeiter des Komsomol-Gebietskomitees – nennen wir ihn Sascha, zur festgesetzten Zeit auf dem Bahnhof der Stadt. Durch die Instruktionen, die wir über uns hatten ergehen lassen müssen, war unsere Stimmung nicht gerade die beste, als wir in den Wagen des internationalen Expresszuges Moskau – Warschau einstiegen. Am Morgen des nächsten Tages trafen wir wohlbehalten in der Hauptstadt der Volksrepublik Polen ein.
Auf dem Warschauer Bahnhof näherte sich unserem Wagen ein gut aussehender, sportlich gekleideter junger Mann und fragte, wer wir seien und woher wir kämen. Als er erfuhr, dass wir genau die waren, die er abholen sollte, begrüßte er uns freundschaftlich und stellte sich als unser Dolmetscher vor. Er sprach tatsächlich vollkommen frei und völlig ohne Akzent Russisch. Auf die Frage, weshalb er denn die russische Sprache so gut beherrschte, antwortete unser Dolmetscher – nennen wir ihn Stasik, dass er lange Zeit in der UdSSR gelebt habe und erst Mitte der 50er Jahre als Pole in seine Heimat repatriiert wurde.
Sofort beschloss ich, meine Polnischkenntnisse aufzufrischen und so tauschte ich mit Stasik ein paar allgemeine Gedanken zu kulturellen Themen aus, wobei ich seine volle Zustimmung erfuhr. Dann kam Stasik schnell zur Sache. Ohne alle Formalitäten fragte er kurz, ,womit' wir gekommen seien. Da niemand von uns die Frage verstand, erklärte er, wegen unseres Unverständnisses leicht gereizt: „Na, was habt ihr mitgebracht – Gold, Kaviar, Cognac, Nylonstrümpfe, Jeans, Westgeld?“ Unsere Antwort verdross und enttäuschte ihn sehr. Traurig schaute er auf uns und nach einigem Nachdenken sagte er entschlossen: „Also machen wir es so, Leute. Ihr werdet im Stadtzentrum wohnen, Hotel „Polonia“ (wenn ich mich nicht täusche – N. E.). Das ist gar nicht weit von hier. Die Adresse und den Weg dorthin schreibe ich gleich auf.. So, jetzt noch die Gutscheine für Mittagessen und Abendbrot. Und auch gleich fürs Frühstück – für den Fall, dass ich morgen früh nicht komme. Falls irgendetwas übersetzt werden soll oder wenn es sonst irgendwelche Probleme geben sollte, dann wendet ihr euch an Nikolai, er weiß über alles Bescheid. Stasik klopfte mir freundschaftlich auf die Schulter, setzte zum Abschied ein breites Lächeln auf und verschwand für immer.
Wir blieben allein, trotzdem gelangten wir irgendwie zum Hotel, da es wirklich nicht weit vom Bahnhof entfernt war. Die Hotel-Rezeption wusste von unserer Ankunft, und unsere Zimmer waren bereits fertig. So packten wir unsere Sachen aus, zogen uns um und begaben uns einträchtig zum Speisesaal, wo uns ein – nach unseren Begriffen – sehr anständiges Mittagessen erwartete. Danach kehrten die meisten in ihre Zimmer zurück, um sich erst einmal nach der anstrengenden Reise zu erholen. Doch ich war nicht müde und schlug unserem Leiter Sascha vor, ein wenig die Ansichten von Warschau zu genießen. Deshalb fuhren wir mit dem Lift in die Bar, die sich auf der obersten Etage des Hotels befand. Dort kam eine hübsche, modisch gekleidete Dame in mittleren Jahren auf uns zu. Sie hatte gehört, dass wir Russisch sprachen, und stellte sich als Mitarbeiterin der Jugendtourist- Organisation „Sputnik“ vor, die für unsere Reise zuständig war, auch für unseren kurzen Aufenthalt in Warschau.
Ich erkundigte mich bei ihr danach, was sie uns an diesem für uns einzigen Tag in Warschau zu besichtigen empfehlen könne. Denn morgen ginge es nach Wrocław, wo uns der offizielle Hauptteil unserer Reise erwarten würde. „Na gut,“ antwortete sie, „ am Abend ist es am besten, einfach durch Warschau zu schlendern; es gibt hier so viele interessante schöne Plätze und historische Denkmäler. Außerdem ist das eigentlich die beste Art, sich auf diese Weise zu erholen.“ Und plötzlich wechselte sie unerwartet zu einem anderen Thema. „Wissen Sie,“ fuhr sie fort, „ wir empfangen hier in Warschau viele ausländische Gruppen. Und ich möchte Ihnen sagen, dass uns die sowjetischen Gäste ein wenig leid tun, denn wir haben eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu ihnen.“ „Warum tun sie Ihnen leid?“ fragte ich erstaunt. „Weil uns scheint, dass ihr euch hier irgendwie nicht wohl fühlt. Da, wo andere gemütlich spazieren gehen und die Parks und Architekturdenkmäler unserer herrlichen Stadt genießen, da schaut ihr euch nach allen Seiten vorsichtig um, geht nur in Gruppen, manchmal fasst ihr euch sogar bei den Händen. Das ist für uns traurig anzuschauen. Wir möchten sehr gern, dass ihr wisst: ihr seid hier unter Freunden. Glaubt mir bitte, wir bemühen uns sehr, damit ihr euch bei uns wohlfühlt.“
Nach dem Abendbrot versammelte sich die ganze Gruppe, die sich inzwischen schon erholt hatte, in der Empfangshalle des Hotels. Wir diskutierten die Frage, wie dieser einzige Abend in Warschau zu verbringen wäre. Im Prinzip gab es zwei Vorschläge: einfach durch die Stadt zu spazieren oder...
Und hier kam mir plötzlich eine Idee. Um zu erklären, wie sie entstand, muss ich etwas weiter ausholen. Während des Studiums an der Akademie war ich mit einigen polnischen Studenten befreundet. Uns verband die Sprache und eine leidenschaftliche Liebe zum Jazz. In Polen wurde damals die Monatszeitschrift „Jazz“ gedruckt. Darin wurden Artikel zur Geschichte des Jazz, über Jazzfestivals und auch Biografien bekannter Jazzmusiker publiziert. Außer der Zeitschrift „Jazz“ brachten mir meine Freunde auch die damals in Polen sehr beliebten Zeitschriften „Um die Welt“ (Dookola świata) und „Umschau“ (Przekrój), die Nachrichten aus allen Bereichen des kulturellen und politischen Lebens druckten, und zwar nicht nur aus ihrem Land, sondern aus der ganzen Welt. Dank dieser Zeitschriften war ich ganz gut über das kulturelle Leben Polens und besonders Warschaus informiert.
Und nun, da wir in der Empfangshalle des Hotels „Polonia“ saßen und überlegten, wie der Abend zu verbringen wäre, erinnerte ich mich an eine Geschichte, die ich in einer der Zeitschriften gelesen hatte. 1952 hatte Stalin die Idee, der fast völlig während des 2. Weltkrieges zerstörten polnischen Hauptstadt ein Geschenk zu machen. Es wurde beschlossen, im Zentrum Warschaus einen 42-stöckigen Palast im Stil des Stalinschen Monumentalismus zu errichten. Die Höhe betrug zusammen mit der Turmspitze mehr als 230 Meter, das Bauwerk ähnelte äußerlich sehr dem Gebäude des Außenministeriums der UdSSR auf dem Smolensker Platz in Moskau. Mehr als 3500 sowjetische Ingenieure und Arbeiter waren an der Realisierung des Projekts beteiligt. Sie wohnten in speziell für sie gebauten Baracken. Im Juli 1955 war das Gebäude vollendet, das mit Marmor und Bronze geschmückt und innen mit Flachreliefs, wertvollen Hölzern und Stuckarbeiten ausgestattet war. Es wurde zum Symbol der polnisch-sowjetischen Freundschaft und erhielt die Bezeichnung „Palast der Kultur und Wissenschaft“ mit dem Namen J. Stalins.
Nach Beendigung des Baus wurden die Baracken, in denen die Bauarbeiter gewohnt hatten, abgerissen – bis auf eine. Die Studenten des Warschauer „Polytech“ (des Polytechnischen Instituts – N.E.) baten darum, sie zu erhalten, da sie die Baracke für eigene Zwecke nutzen wollten – denn freie Räume waren im Warschau der 50er Jahre Mangelware. Die Studenten machten aus dieser Baracke ihren Klub. Außen wurde sie nicht verändert – sie sah wie früher abgewrackt und armselig aus. Das Innere der Baracke aber verwandelten sie in einen Konzertsaal der Extraklasse. Teures Parkett wurde verlegt, Wände mit Paneelen aus edlem Holz verkleidet. Nach ihrem äußeren Aussehen bekam die Baracke die Bezeichnung „Stodoła“, was auf Polnisch „Scheune“ heißt.
Doch diese Bezeichnung hinderte die „Scheune-Stodoła“ nicht daran, einer der berühmtesten Konzertsäle Warschaus zu werden. Der Name war schwerlich in den Handbüchern unter den Kultureinrichtungen Warschaus zu finden. Doch viele weltbekannte Berühmtheiten hielten es für eine Ehre, in der „Stodoła“ aufzutreten, darunter Louis Armstrong und viele andere Jazz- und Kabarett-Stars. Hier wurden die ersten internationalen Festspiele der Jazzmusik in Polen durchgeführt („Jazz Jamboree“). Wenn es keine Konzerte gab, fanden im Saal Studententreffen, Filmvorführungen oder einfach Tanzabende statt. Überhaupt wurde „Stodoła“ das erste informelle Kulturzentrum der polnischen Hauptstadt. So kam es, dass ich meinen Kameraden vorschlug, dieses Zentrum an unserem ersten Abend in Warschau zu besuchen, zumal es sich fast nebenan befand. Mein Vorschlag wurde angenommen.
Als wir ins „Stodoła“ kamen, fand dort gerade ein Tanzabend statt. Es spielte ein Jazz-Orchester im damals europaweit modischen Big-Beat-Stil. Im Saal waren viele Leute, hauptsächlich Studenten. Einige tanzten, die meisten jedoch hielten bauchige Bierflaschen in den Händen, hörten der Musik zu oder unterhielten sich weiter weg vom Orchester einfach über irgendwas. Die Mitglieder unserer Gruppe verteilten sich im Saal. Sascha wich seit unserer Ankunft in Warschau nicht von meiner Seite. Wir standen beide am Eingang, wo es nicht ganz so laut war, und unterhielten uns ebenfalls.
Plötzlich zog mich Sascha ängstlich am Arm und wies mit einer Kopfbewegung auf zwei in der Nähe stehende junge Leute in strengen Abendanzügen. Sie stritten lebhaft miteinander und zeigten dabei auf uns. Wir erstarrten und harrten der Dinge, die da kommen sollten. Zu unserem Schrecken sahen wir, dass die Zwei in unsere Richtung strebten. Sascha wurde blass, weil er Schlimmes ahnte. Mit Mühe überwand ich meine Aufregung, denn ich wollte möglichst schnell erfahren, weshalb sie sich gerade für uns interessierten. Einer der beiden jungen Leute, offenbar ein Pole – denn er wandte sich in einwandfreiem Polnisch an mich – sagte, sein Freund behaupte, dass er mich kennen würde und vor kurzem gesehen habe, er könne sich aber nicht erinnern, wo. Ich widersprach und sagte, dass sein Freund sich wohl irren müsse, ich hätte ihn noch nie gesehen. Der Pole übersetzte seinem Freund meine Antwort ins Englische. Der war mit meiner Meinung sichtlich nicht einverstanden, gestikulierte verzweifelt weiterund begann offenbar, noch einige Beweise anzuführen.
Nach der Übersetzung seiner Worte ins Polnische war mir klar, dass der sonnengebräunte junge Mann weiter behauptete, dass er mich kennen würde und wir uns schon getroffen hätten. Die Situation wurde immer brenzliger und angespannter. Über Saschas blasses Gesicht rann kalter Schweiß. Ich bemühte mich ihn nicht anzuschauen, denn seine Gedanken waren leicht zu erraten. Was sind das für Leute? Wovon sprechen sie und was wollen sie von uns? Handelt es sich um ein zufälliges Treffen? Was ist zu tun?
Leider ließ mir die Situation, in deren Mittelpunkt ich stand, kaum eine Sekunde Zeit zum Übersetzen. Ich versuchte unseren Gesprächspartnern möglichst überzeugend zu erklären, dass dies wohl ein Missverständnis sei. „Das ist unmöglich“, wiederholte ich nachdrücklich. „Wir sind erst heute Morgen in Warschau angekommen. Ich war überhaupt noch nie in Polen, ich wohne in Moskau!“ Ohne die Übersetzung meiner Worte ins Englische abzuwarten, schrie der dunkelhäutige Unbekannte plötzlich laut: „Moscow, Moscow, Marlene Dietrich!!!“ Und da verstand ich plötzlich alles!
Das war der Mann, der mir die „übrige“ Eintrittskarte für das Konzert von Marlene Dietrich in Moskau vor einigen Monaten verkauft und neben dem ich fast zwei Stunden im Konzertsaal des Estradentheaters gesessen hatte. Klar, warum ich ihn nicht sofort erkennen konnte – war er doch in Moskau in indischer Nationaltracht aufgetreten und sein Gesicht größtenteils mit einem orangefarbenen Turban verdeckt. Wir Drei verstanden nun, was geschehen war, und gerieten außer uns vor Begeisterung über dieses Zusammentreffen der Umstände, lachten lauthals und klopften uns gegenseitig auf die Schultern.
In diesem Moment war es besser, Sascha nicht anzusehen. Doch endlich hatte ich Zeit, ihm die Hintergründe dieser Geschichte, die für mich selber unglaublich schien, zu erklären. Als Sascha sich ein wenig, wenn auch nicht ganz, beruhigt hatte, bemühte er sich, auch ein Lächeln vorzutäuschen. Doch dann zeigte er auf seine Uhr und gab zu verstehen, dass noch unaufschiebbare Dinge auf uns warteten und wir uns deshalb trennen müssten. Wir verabschiedeten uns sehr herzlich von unseren neuen Freunden und gingen zusammen mit der ganzen Gruppe ins Hotel zurück.
So ging die Geschichte zu Ende, an deren Anfang das Konzert von Marlene Dietrich gestanden hatte. Allerdings: wer wusste schon, ob sie tatsächlich damit abgeschlossen war? Nach zwei Wochen war unsere Reise nach Polen endgültig vorbei, und alle Mitglieder der Gruppe kehrten nach Smolensk zurück, von wo alle an ihre Arbeitsorte weiterfuhren. Die Reise verlief eigentlich genauso, wie es der Gebietssekretär zu Beginn in seinem Wunsch zum Ausdruck gebracht hatte – nämlich in einer Atmosphäre der Freundschaft und Zusammenarbeit. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass unser Gruppenleiter Sascha, zu dessen Verpflichtungen – wie ich erfuhr – es gehörte, über jeden von uns eine ausführliche Einschätzung unseres Verhaltens während der Reise abzugeben, den Vorfall im „Stodoła“ keineswegs so harmlos beschrieben hat. Denn schon der Vorschlag, diesen Klub, der ja keinen unstrittigen Ruf hatte, zu besuchen, konnte nicht zu meinen Gunsten gewertet werden. Es ist schwer zu sagen, ob es tatsächlich so abgelaufen ist. Jedoch wurde ich in den nächsten 20 Jahren, bis zum Beginn der „Perestroika-Zeit“, nicht mehr auf Dienstreisen ins Ausland geschickt.
Nachwort
Diese Geschichte ist schon viele Jahre her, doch nichtsdestoweniger hinterließ sie eine deutliche Spur in meinem Leben. Es gibt eine Menge von Mythen, die sich um Marlene Dietrich ranken: war sie wirklich die größte Schauspielerin und Sängerin, das Sex-Symbol des 20. Jahrhunderts usw.? Doch für mich blieb sie vor allem die einmalige Sängerin, deren Stimme, wie es Hemingway ausdrückte, fähig war, Herzen zu brechen.
Ich habe zu Hause Aufzeichnungen vieler ihrer Lieder, und manchmal, wenn die Stimmung danach ist, höre ich sie. Und wenn aus den Verstärkern der Stereoanlage ihre unverwechselbare Stimme ertönt, kommt mir die Erinnerung an den dunklen Saal des Moskauer Estradentheaters, der Vorhang hebt sich, und auf die hell beleuchtete Bühne tritt ein bejahrter Mann im strengen schwarzen Anzug und sagt nur zwei Worte: MARLENE DIETRICH!
(Übersetzung aus dem Russischen ins Deutsche Konrad Geburek )
Qualitätszeichen * „Made in USSR“
 Diese Geschichte nahm ihren Anfang Ende der 70-er Jahre, in einer Zeit, die sowjetische Historiker später die „Zeit der Stagnation“ nannten. Es war im September, die Tage wurden kürzer, die Abende merklich kälter und der nahe Herbst ließ sich nicht mehr verleugnen. An einem solchen Abend traf sich eine kleine Gruppe von jungen Leuten auf einer der zentralen Straßen der Hauptstadt Moskau. Sie kannten sich seit ihrer Schul- und Studienzeit recht gut. Ihr Treffen hatte keinerlei besonderen Zweck, außer dass man miteinander plaudern und den Abend gemeinsam verbringen wollte. Allerdings gab es auch keine produktiven oder sonst welche Ideen, sodass man bald wieder auseinanderging – alle hatten schließlich etwas Unaufschiebbares vor. Kurz gesagt, bald blieb ich mit einem meiner alten Bekannten zurück, nennen wir ihn Wolodja F. Er arbeitete damals in der Hauptverwaltung einer Militärbehörde.
Diese Geschichte nahm ihren Anfang Ende der 70-er Jahre, in einer Zeit, die sowjetische Historiker später die „Zeit der Stagnation“ nannten. Es war im September, die Tage wurden kürzer, die Abende merklich kälter und der nahe Herbst ließ sich nicht mehr verleugnen. An einem solchen Abend traf sich eine kleine Gruppe von jungen Leuten auf einer der zentralen Straßen der Hauptstadt Moskau. Sie kannten sich seit ihrer Schul- und Studienzeit recht gut. Ihr Treffen hatte keinerlei besonderen Zweck, außer dass man miteinander plaudern und den Abend gemeinsam verbringen wollte. Allerdings gab es auch keine produktiven oder sonst welche Ideen, sodass man bald wieder auseinanderging – alle hatten schließlich etwas Unaufschiebbares vor. Kurz gesagt, bald blieb ich mit einem meiner alten Bekannten zurück, nennen wir ihn Wolodja F. Er arbeitete damals in der Hauptverwaltung einer Militärbehörde.
Wir bummelten die Sretenka-Sraße abwärts und erinnerten uns an gemeinsame Bekannte und lustige Geschichten, an denen wir gelegentlich beteiligt waren. Mein Freund zeichnete sich stets durch ein besonderes Gefühl für Humor sowie durch ganz außergewöhnliche Ideen aus. Daher war ich auch nicht sonderlich überrascht, als ich unerwartet die Frage vernahm: „Sag, was hält uns eigentlich jetzt in diesem grauen Moskau, wo es mit jedem Tag immer ungemütlicher wird? Ich habe da eine Idee: lass uns für ein paar Wochen ans Schwarze Meer fahren!“ „Und was werden wir dort tun?“ erkundigte ich mich vorsichtig. „Na, was schon? Baden, sich am Strand sonnen und Mädchen kennenlernen.“ „Ausgezeichnet!“ sagte ich. „Doch wer wird uns Urlaub geben und woher kommt übrigens das Geld?“ „Kein Problem, ich habe schon alles bedacht. Wir fahren in einen Betrieb, der unserer Behörde unterstellt ist – und zwar als Mitglieder der Kommission zur Evaluierung der produzierten Waren.“ „Toll!“ stimmte ich zu. „Ich bin hundertprozentig dafür! Aber ich habe nur zwei Fragen. „Erstens“, sagte ich und schlug bescheiden meine Augen nieder, „verstehe ich nichts von eurer sogenannten „Spezialproduktion“. Und außerdem muss ich arbeiten, ich habe in diesem Jahr keinen Urlaub mehr.“ Wolodja schaute mich mitleidig an, so wie ein Lehrer auf einen äußerst beschränkten Schüler. „Zunächst deine erste Frage: wir haben dort überhaupt nichts zu tun. Wir sitzen ganz einfach am Strand, unterhalten uns mit den Mädchen, essen Obst... Irgendwann bringt man uns die entsprechenden Papiere, die unterschreiben wir und … unterhalten uns weiter, baden und sonnen uns. Und was deinen Urlaub betrifft: wer spricht hier überhaupt von Urlaub? Das wird natürlich eine Spezial-Dienstreise!“ „Hör zu“, sagte ich ziemlich ernst, „ich arbeite doch nicht in deinem Ministerium. Wer wird mich auf Dienstreise schicken, am Ende zahle ich noch die Rechnung?“
Mein Freund schüttelte traurig den Kopf, seufzte, holte schweigend aus der Jackentasche ein Notizbuch und fragte: „Wie ist der Name deines Chefs und was für eine Dienststellung hast du?“ Ich arbeitete damals als leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem kleinen biochemischen Labor an der Timirjasew-Akademie. Um das Spiel nicht zu verderben, nannte ich meinem Freund den Namen unseres Rektors sowie die Telefonnummer seines Sekretariats. Doch dann schien mir das Ganze doch etwas zu weit zu gehen und so verabschiedete ich mich unter einem Vorwand von Wolodja – und bald darauf hatte ich die ganze Geschichte vergessen.
Um so größer war mein Erstaunen, als nach ein paar Tagen plötzlich das Telefon in dem Labor, wo ich arbeitete, klingelte – und man mich bat, umgehend zum Prorektor für wissenschaftliche Angelegenheiten zu kommen. Ich war durch diesen unerwarteten Anruf ziemlich aufgeregt und fragte die Sekretärin, ob ich vielleicht irgendwelche Berichte oder Pläne für unsere Forschungen mitbringen sollte. „Nein, nein“, antwortete sie, „Anatolij Iwanowitsch möchte einfach ein Gespräch mit Ihnen führen.“ Von Neugier erfüllt, aber auch mit einem irgendwie unruhigen Gefühl erschien ich im Vorzimmer des Prorektors. Er begrüßte mich freundlich und fragte nach meinem Befinden. Dann schaute er in eine Mappe, zog ein Blatt heraus und reichte es mir, ohne etwas zu sagen. Auf dem Telegramm, das oben den roten Vermerk „Regierungssache“ trug, stand geschrieben: „Wir bitten, Ihren Mitarbeiter N. A. Epstein kurzfristig zu unserer Verfügung für eine zweiwöchige Dienstreise freizustellen. Es handelt sich um die Teilnahme an der Arbeit der Staatlichen Evaluierungskommission für optische Erzeugnisse, die von Betrieben unseres Ministeriums hergestellt werden. Wir garantieren die Übernahme aller Ausgaben, die mit der Dienstreise verbunden sind.“ Darunter die Unterschrift: Minister für Verteidigungsindustrie der UdSSR, S. A. Swerew.
Der Prorektor verlor kein Wort, doch in seinen Augen war die kaum zu verbergende Frage zu lesen: „Was soll das bedeuten?“ Ich gab ihm das Telegramm zurück und zuckte verlegen mit den Schultern. „Ich weiß nicht, Anatolij Iwanowitsch, wahrscheinlich hat mich einer von deren Mitarbeitern empfohlen“, äußerte ich mich vorsichtig. „Bei unseren Arbeiten benutzen wir manchmal optische Geräte: Mikroskope, Spektrometer, Fluorimeter usw. Das ist für mich eigentlich auch irgendwie ein Rätsel“, fügte ich hinzu und schlug bescheiden die Augen nieder, um mein schlechtes Gewissen zu verbergen. Meine Erklärung, wie seltsam sie auch war, wirkte auf den Prorektor doch beruhigend. „Gut“, sagte er, „ich meine, du wirst wohl fahren müssen. Natürlich nur, wenn du nichts dagegen hast.“ Es verschlug mir die Sprache und so konnte ich nur schweigend mit dem Kopf nicken. Damit war mein Gespräch mit dem Prorektor beendet. Und mit dem unterschriebenen Dienstreiseformular stürmte ich wie der Wind aus dem Zimmer.
Am selben Tag rief ich Wolodja an, nannte ihn ein Genie und sagte, dass mit der Dienstreise alles geregelt sei. Doch wie sollte es nun weitergehen? Die Antwort klang anfangs etwas ungenau, doch dann kam der Vorschlag, dass wir uns morgen an der Metrostation Krasnopresnenskaja treffen und Flugtickets bestellen sollten. Dort befanden sich die Kassen der Aeroflot.
Am nächsten Morgen trafen wir uns an dieser Station, einigten uns über das Abflugsdatum und kauften Flugtickets der 1. Klasse nach Simferopol. Darauf verabschiedeten wir uns eilig, da ich noch pünktlich zur Arbeit erscheinen wollte. An dem festgelegten Tag traf ich mich mit Wolodja an einer der zentralen Metrostationen, um mit ihm gemeinsam zum Flughafen zu fahren. Wir waren beide „kampfbereit“ mit Badeutensilien und Krim-Reiseführern ausgerüstet.
Unterwegs erkundigte ich mich, wer denn noch mit uns fahren würde. Wolodja sagte, dass noch einige Mitarbeiter seiner Dienststelle mitfliegen würden. Der Rest seien Spezialisten aus dem Leningrader optisch-mechanischen Institut LOMO, die würden am Flughafen Simferopol zu uns stoßen. Doch etwas an Wolodjas Tonfall und überhaupt an seinem Benehmen gefiel mir nicht. Irgendwie waren seine gewohnte Fröhlichkeit und sein Optimismus verschwunden. Dafür erschien er mir nachdenklicher und besorgter als sonst, was gar nicht zu ihm passte. „Was ist los?“ fragte ich beunruhigt. „Weißt du, es ist, ehrlich gesagt, ein kleines Missgeschick passiert. Unerwartet erkrankte der Vorsitzende unserer Kommission und er kann leider nicht mit uns fliegen. Aber bleib ruhig. Wir haben einen Ausweg gefunden. Es wurde beschlossen, an seiner Stelle als Vorsitzenden der Staatlichen Kommission einen anderen zu benennen – nämlich dich.“
Ich war sprachlos und wie vor den Kopf geschlagen. Meine Stimmung änderte sich natürlich augenblicklich. Mir war klar, dass von Meer, Strand, Wein und Mädchen keine Rede mehr sein konnte. Stattdessen war eine Situation entstanden, die für mich nahezu hoffnungslos erscheinen musste.
„Du bist wohl ganz und gar verrückt!!!“ schrie ich entsetzt. „Ich verstehe überhaupt nichts von Technik. Ich kann gerade nicht einen Schraubenschlüssel von einem Schraubenzieher unterscheiden. Ich kenne weder die Produktion noch die Terminologie, ich bin nicht mal in der Lage, technische Dokumentationen zu lesen. Schließlich war ich niemals in meinem Leben in einem Betrieb und habe keine Ahnung davon.“ „Das ist gerade gut!“ rief er mit offensichtlicher Erleichterung aus. „Je weniger du dich mit all dem auskennst, desto besser. Hauptsache, du hast eine allgemeine Vorstellung. Du bist schließlich promoviert. Da hat man euch doch etwas beigebracht – oder?“ „Beigebracht... aber leider hat man nicht voraussehen können, dass man auf solche Hochstapler wie dich treffen könnte. Nein, das ist doch völliger Schwachsinn!“ Ich ließ die ganze Wut aus mir heraus und schwieg beleidigt. Mir war klar geworden, dass man mich in diesem Fall einfach zum Narren gehalten hatte. Ich war fest entschlossen, die Freundschaft mit Wolodja ein für alle mal zu beenden.
Im Flugzeug sprachen wir kaum ein Wort. Meine Stimmung wurde auch nicht besser, als uns die Stewardessen zum Essen für Passagiere erster Klasse kleine Fläschchen mit Rkaziteli-Wein servierten. Schweigend trank ich den Wein gleich aus der Flasche und schaute aus dem Fenster. Dennoch wurde ich ein ungutes Gefühl nicht los. Auf dem Flughafen in Simferopol trafen wir uns mit der aus Leningrad bereits früher eingetroffenen Gruppe der Mitarbeiter von LOMO. Ich bemerkte, dass unter den Optik-Spezialisten hübsche junge Frauen waren, und zwar fast genau so viele wie Männer. „So ist es richtig“, dachte ich, „ die Leningrader waren schon immer berechnend und vorausschauend.“ Danach wurden alle Kommissionsmitglieder auf einige PKWs verteilt, die für uns bereitstanden. Und so machten wir uns auf den Weg. Nach einer kleinen Mittagspause im Restaurant „Alte Krim“ steuerte der Auto-Konvoi Feodossija an, das am südöstlichen Ufer der Halbinsel Krim liegt. In der Nähe der Stadt befand sich das Rüstungswerk N, das neben militärischen Spezialerzeugnissen auch Geräte des täglichen Gebrauchs herstellte. Hierbei handelte es sich um Schulmikroskope. Eben diese verdienten nach Meinung der führenden Spezialisten des Ministeriums und des wissenschaftlichen Instituts LOMO voll und ganz die Zuerkennung der höchsten Qualitätskategorie. Man brachte uns in geräumigen gemütlichen Zimmern des Betriebshotels unter und ließ uns bis zum Morgen in Ruhe.
Am nächsten Morgen gab es ein Frühstück, das nach Speisenangebot und Service-Niveau dem Essen im Restaurant „Alte Krim“ in nichts nachstand. Danach wurden alle Mitglieder der Staatlichen Kommission, ungefähr 15 Personen, in das geräumige Kabinett des Werkdirektors gebeten, das man wohl eher einen kleinen Saal nennen konnte. Dort saßen schon an einem riesigen Tisch die Leiter der verschiedenen Betriebsabteilungen. Mein Versuch, irgendwo ein heimliches Plätzchen hinter einem breiten Rücken zu finden, wurde sofort unterbunden. In höflicher Form forderte man mich auf, neben dem Direktor Platz zu nehmen. Der Direktor wandte sich an die Gäste, sprach ein paar freundliche Worte und hieß die Anwesenden willkommen. Dann stand er auf und begann mit wohltönender lauter Stimme, die sehr an den Sprecher des Sowjetischen Rundfunks erinnerte, den Befehl des Ministers für Verteidigungsindustrie zur Berufung der Staatlichen Evaluierungskommission zu verlesen. Diese wurde beauftragt, ihre Arbeit im optisch-mechanischen Werk N. aufzunehmen. Danach fügte er mit etwas ruhigerer Stimme von sich aus ein paar Worte hinzu und betonte, dass auf die Kommissionsmitglieder eine anstrengende und verantwortungsvolle Arbeit warte, weil ausgerechnet „unser Erzeugnis“ – als erstes auf der Krim – zur Evaluierung für das Staatliche Qualitätszeichen ausgewählt worden sei.
Weiter sagte der Direktor: „Unsere Aufgabe sehen wir darin, alle notwendigen Bedingungen für die Arbeit der Kommission zu schaffen. Erstens wurde eigens eine Blumenschau organisiert. Dies trägt zu einer festlichen Atmosphäre bei und wird zweifellos einen positiven Einfluss sowohl auf die Arbeit der Kommissionsmitglieder als auch auf die Werktätigen des Betriebes haben. Zweitens haben wir einen genauen Ablaufplan für die Tätigkeit der Kommission ausgearbeitet. Gleich werde ich den Chefingenieur bitten, diesen Plan an die Kommissionsmitglieder zu verteilen, damit sie sich damit vertraut machen können. Falls es noch irgendwelche Wünsche und Vorschläge gibt, so sind wir bereit, entsprechende Veränderungen und Ergänzungen in diesen Plan einzufügen.“ Danach wurden den Kommissionsmitgliedern in Leder gebundene Mappen übergeben – mit goldener Prägung und einer auf Glanzpapier gedruckten Broschüre, geschmückt mit Krim-Symbolik: „Arbeitsplan der Staatlichen Evaluierungskommission im optisch-mechanischen Betrieb N.“ Das war ein einzigartiges Dokument. Und obwohl seitdem viele Jahre vergangen sind, bedaure ich es immer noch, dass es mir nicht gelungen ist, diese Mappe aufzubewahren. Die Arbeit der Kommission war für ungefähr zwei Wochen berechnet. Der Plan sah Besuche der zahlreichen Museen und Sehenswürdigkeiten der Krim vor, so z.B. der Aiwasowski-Gemäldegalerie, des Hauses von Alexander Grin, der Genueser Festung „Kafa“ und der mittelalterlichen Armenischen Fontäne. Außerdem wurde ein Ausflug in die Siedlung Koktebel und zum Woloschin-Haus geplant, weiterhin ein Ausflug zur Krim-Biostation mit dem Delfinarium, Spaziergänge am Meer nach Sudak und zur „Neuen Welt“ - am Tag und am Abend, mit Freundschaftsessen. Die vielen geplanten Freundschaftstreffen und Dinner stellten meines Erachtens eine ernsthafte Gefahr für jemanden dar, der solchen Herausforderungen nicht gewachsenen war. Man konnte unter diesen Bedingungen zum chronischen Alkoholiker werden. Doch wie sich herausstellte, verfügten alle Mitglieder der Kommission in dieser Beziehung über gute Erfahrung. Was allerdings mich betraf, so kam ich gar nicht dazu, all die seltenen Krimwein-Sorten zu probieren. Ich war ständig gezwungen, feierliche und passende Worte für unsere verantwortungsvolle Mission zu finden. Damals hatte ich leider noch nicht die Fähigkeit, in angeheitertem Zustand Reden zu halten und Toasts auszubringen.
Nach der offiziellen Begrüßung beim Direktor folgte ein kollegiales Frühstück, an das sich eine Betriebsbesichtigung anschloss. Während dieser Besichtigung gab es einen kleinen Zwischenfall. Ich hörte gerade sehr aufmerksam den Erläuterungen einiger Vertreter der Werkleitung zu, die die in letzter Zeit erzielten Erfolge priesen, als ich zufällig auf einen Kanalisationsdeckel trat, den ich nicht bemerkt hatte. Der Deckel war nur lose befestigt und gab deshalb plötzlich nach, sodass ich in einen tiefen Schacht gefallen wäre, wenn mich nicht in diesem Moment einige kräftige Hände festgehalten und an die Oberfläche befördert hätten. Sofort folgten Entschuldigungen der Direktion. Man schwor, den Schuldigen unverzüglich zu finden und die unheilvolle Luke für immer zu schließen. Als sich alle ein wenig beruhigt hatten und die Besichtigung fortgesetzt wurde, näherte sich unauffällig mein „Freund“ Wolodja F. und sagte leise zu mir, ohne seine Schadenfreude zu verbergen: „Das solltest du eigentlich als Warnung verstehen. Wenn etwas mit unserer Sache nicht so klappt, wie es sein soll, kann dich auch ein Stromschlag treffen!“
Nach der Besichtigung war vorgesehen, dass wir uns in einigen Betriebsabteilungen mit Bestarbeitern treffen sollten. Im Anschluss daran war das gemeinsame Essen vorgesehen. Und da spürte ich plötzlich, dass meine Autorität bei den Kommissionsmitgliedern zu wachsen begann. Die Sache war die: das Werk war riesig und seine Gebäudekomplexe lagen sehr weit auseinander. Natürlich war die Direktion stolz auf ihren Betrieb und wollte der Kommission möglichst viele vorbildliche Abteilungen zeigen. Die meisten Werksabteilungen stellten spezielle militärische Ausrüstungen her. Doch für die Besichtigung dieser Betriebsteile war eine spezielle Zugangsgenehmigung erforderlich. Im Unterschied zu den anderen Kommissionsmitgliedern verfügte ich leider nicht über ein solches Papier. Das brachte die Direktion in Verlegenheit, denn ohne den Vorsitzenden konnte sie schlecht die Kommission durch all diese Abteilungen führen. So kam es, dass die Produktionsbesichtigung und somit auch die Zeit bis zum Mittagessen erheblich verkürzt wurden. Ich spürte geradezu physisch die dankbaren Blicke und moralische Unterstützung der meisten Mitglieder der Kommission, besonders ihrer „bessere Hälfte“.
Während des Essens äußerten sich alle sehr zufrieden mit dem Bemühen der Direktion, die Tätigkeit der Kommission auf „hohem technischen und kulturellen Niveau“ zu unterstützen. Da ohnehin noch niemand den Gegenstand der bevorstehenden Evaluierung – das Mikroskop MS-1 – gesehen hatte, konzentrierten sich die Anwesenden mehr auf die vorgelegte Speisekarte und widmeten sich der Festigung freundschaftlichen Kontakte. Das Mittagessen verlief in einer freundlichen, ja herzlichen Atmosphäre. Die Zeit danach bis zum Abendbrot sollte laut Plan eigentlich dem „Kennenlernen der technischen Dokumentation“ dienen. Allerdings beschlossen die meisten Kommissionsmitglieder, den Nachmittag zum Kennenlernen der Gegend zu nutzen. Da man aber in so kurzer Zeit die Schönheiten der Natur auf der Krim nicht annähernd erfassen konnte, setzte man nach dem Abendbrot, das ebenfalls auf „hohem kulturellen Niveau“ verlief, die Spaziergänge am Meeresufer – meist paarweise – fort. Das zog sich bis in den späten Abend hin.
Am Morgen des nächsten Tages versammelten sich alle Kommissionsmitglieder erneut im Kabinett des Werkdirektors. Auf dem großen Tisch, mit grünem Tuch bedeckt, standen für jeden von uns hübsche polierte Kästchen aus dunklem Holz bereit. Darin befand sich ein glänzender vernickelter Gegenstand, das „Schulmikroskop MS-1“, das der Evaluierung unterzogen werden sollte. Daneben lagen dicke Stapel mit der technischen Dokumentation. Nun gaben der Chefingenieur und der Cheftechnologe des Werkes die entsprechenden Erläuterungen. Danach forderte ich als Vorsitzender die Kommissionsmitglieder auf, Fragen zu stellen und ihre Meinung zu sagen. Fragen wurden so gut wie keine gestellt, dafür war die Kommission der einhelligen Meinung, bei dem Gerät handle es sich um ein Meisterwerk, ja um ein leuchtendes Beispiel des technischen Fortschritts, vielversprechend und zukunftsorientiert, absolut notwendig für Schule und Volkswirtschaft usw. und so fort. Doch plötzlich wurde diese Welle der Begeisterung unterbrochen, und zwar aus einer völlig unerwarteten Richtung. Um das Wort bat nämlich ein Mitglied der Kommission, die sich uns erst im Werk angeschlossen hatte. Dieser junge Mann, von nicht allzu großem Wuchs, nennen wir ihn Sergej, wies sich als Vertreter der Krim-Filiale von „Gosstandard“ * aus – einer Organisation, die die Aufgabe hatte, die Qualität der zu testenden Geräte mit internationalen Standards zu überprüfen. Sergej, der sich bisher still und unauffällig verhalten hatte, zeigte sich nunmehr als ein ausgesprochen unnachgiebiger und akribischer Mensch. In kurzer Zeit gelang es ihm, eine solche Menge von Fehlern und Vergehen in der technischen Dokumentation aufzuzeigen, die natürlich keiner von uns vermutet hätte. Er hatte auch Zweifel daran, dass das Mikroskop MS-1 einem Vergleich mit bekannten internationalen Mustern standhalten könnte. Dazu kam noch, dass er während des Rundgangs in den Abteilungen mit einigen Werksarbeitern gesprochen hatte, die mit der Produktion von MS-1 zu tun hatten. Dabei war er dahintergekommen, dass sie keinerlei Nachweis über die Absolvierung von speziellen Qualifikationskursen hatten, die in diesem Falle unbedingt erforderlich gewesen wären.
Die Atmosphäre im Kabinett des Direktors begann zu eskalieren. Diese Stimmung verstärkte sich noch, als die Werksingenieure unter sich einen Streit begannen. Die einen hielten die von dem „Gosstandard“- Vertreter aufgedeckten Fehler für bedeutungslos, die anderen wollten klären, wer schuld daran sei. Nach einer kurzen Diskussion wurde eine Kompromisslösung angenommen: die Ingenieure sollten ihren Streit in ruhiger Atmosphäre zu Ende bringen, die Sitzung der Kommission wurde geschlossen und auf den nächsten Tag verlegt. Die restlichen Kommissionsmitglieder hatten frei, sie sollten zu Mittag essen und danach das Kulturprogramm fortsetzen, das an diesem Tag einen Gruppenbesuch der Aiwasowski-Gemäldegalerie vorsah.
Am nächsten Morgen erfuhren wir, dass es den Ingenieuren nicht ganz gelungen war, die technischen Meinungsverschiedenheiten mit dem Gosstandard-Vertreter auszuräumen. So entstand die Idee, das Ganze vorerst nicht allen Kommissionsmitgliedern vorzutragen, sondern zu versuchen, darüber im kleinen Kreis nochmals zu diskutieren – und zwar sollten dazu der Direktor, der Chefingenieur, der Vorsitzende der Staatlichen Kommission und der Gosstandard-Vertreter gehören.
Als den am besten geeigneten Ort zur Schlichtung der Meinungsverschiedenheiten schlug der Werkdirektor das Kabinett des Ersten Sekretärs des Stadtkomitees der Partei vor, mit dem man sich über das Treffen schon vorher geeinigt hatte. Den übrigen Kommissionsteilnehmern empfahl man, das Kulturprogramm weiter fortzusetzen, wogegen keiner etwas einzuwenden hatte. Uns bat der Direktor, in seinem schwarzen „Wolga“ Platz zu nehmen, und so fuhren wir ins Stadtkomitee der KPdSU, das nur wenige Kilometer vom Werk entfernt war.
Dort wartete man schon auf uns. Wir passierten eilig das Vorzimmer und betraten das geräumige Kabinett des Ersten Sekretärs. Hinten stand ein großer Schreibtisch, an den sich ein kleinerer, T-förmiger Tisch mit einigen Sesseln anschloss. An der Wand hinter dem Schreibtisch hing ein großes Porträt des Generalsekretärs des ZK der KPdSU, des Genossen Leonid Iljitsch Breshnew, in Marschalluniform mit dem Orden des Sieges und zwei Goldenen Sternen eines Helden der Sowjetunion (den dritten Goldenen Stern erhielt L. I. Breshnew bald nach Beendigung der Arbeit unserer Kommission, im Dezember 1978; den vierten Goldenen Stern im Dezember 1981 anlässlich seines 75. Geburtstages – Anm. des Verfassers).
Der Erste Sekretär des Stadtkomitees, ein kräftiger Mann mittleren Alters, ähnelte irgendwie dem in seinem Kabinett hängenden Porträt. Er begrüßte uns freundlich, bat uns, an dem kleinen Tisch Platz zu nehmen und forderte uns auf, ihm von unseren Problemen zu erzählen. Nach Ausführungen des Direktors, die in aller Kürze das Wesentliche der entstandenen Situation umrissen, erhielt das Wort der Vertreter von Gosstandard. Sergej zählte überzeugend und vernünftig die vorhandenen Verstöße und Abweichungen von den technischen Bestimmungen auf und schlug schließlich vor, die aufgezeigten Mängel zu beseitigen und das zu testierende Gerät zu vervollkommnen.
Der Sekretär des Stadtkomitees erhob sich von seinem Platz, machte ein nachdenkliches Gesicht und begann langsam durch den Raum zu wandern. Zunächst ging es ihm darum, Sergej besser kennenzulernen, er interessierte sich für dessen Bildung, wollte wissen, woher er sei und wer ihn zu dieser Arbeit in unserer Kommission geschickt habe. Als er erfuhr, dass er ein Hiesiger, d.h. einer von der Krim sei, zeigte sich der Sekretär scheinbar erfreut. „Sie stellen sehr richtige Fragen, junger Mann“, sagte er. „Wir brauchen Menschen mit Prinzipien. Und ich denke, Sie werden es noch weit bei uns bringen.“ Sergej verstand die Doppeldeutigkeit der letzten Worte des Sekretärs, sein Gesicht verdüsterte sich und er senkte den Kopf.
„Jedoch“, fuhr der Sekretär fort, „ dürfen wir nicht vergessen, dass die von uns zu betrachtende Frage nicht nur einen technischen, sondern auch einen sehr wichtigen politischen Aspekt hat. Nehmen wir mal an, wir wären mit Ihrem Vorschlag, Genosse Sergej, einverstanden und würden unserem Mikroskop nicht das Qualitätszeichen zuerkennen. Haben Sie bedacht, was dann unsere Arbeiter dazu sagen würden, die sich schon so lange auf diesen Festtag mit großer Erwartung vorbereitet haben? Mehr noch, am Vorabend des Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution kann dies vielleicht von einigen so gewertet werden...“, in diesem Moment veränderte sich die Stimme des Sekretärs des Stadtkomitees und die Gäste erstarrten in ängstlicher Erwartung dessen, was auch folgen sollte, „dass es sich hier um eine politische Provokation handelt!“ Eine lähmende Angst erfasste mich, besonders um Sergej, dem bereits versprochen war, dass er es „weit bringen“ würde. Den anderen ging es nicht besser. Doch als der Sekretär seine Rede beendet hatte, lächelte er plötzlich und sagte: „Wenn ihr meine Meinung wissen wollt, so rate ich euch: fahrt los, überlegt noch einmal alles genau und ich bin überzeugt, dass ihr ganz bestimmt zu einer richtigen Entscheidung kommen werdet. Denn deswegen seid ihr ja hergekommen.“ Und er kehrte zu seinem Sessel hinter dem Schreibtisch zurück und gab damit zu verstehen, dass die Audienz beendet war.
Die folgende Sitzung der Evaluierungskommission fand am nächsten Morgen statt, sie verlief sachlich und dauerte nicht sehr lange. Zu Beginn informierte der Werkdirektor darüber, dass die kleinen Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt seien und die Arbeit der Kommission fortgesetzt werden könne. Die Kommissionsmitglieder schauten fragend auf den Vertreter von Gosstandard, der jedoch in Gedanken versunken auf vor ihm liegende Papiere blickte und keine Reaktion zeigte. Danach berichteten die Vertreter der Werkleitung über die technischen Vorzüge des Mikroskops MS-1 und darüber, in welche Länder es exportiert wird: Polen, Bulgarien, die DDR. Sogar Japan, das „Land der aufgehenden Sonne“, wurde genannt, das für die technische Vollkommenheit seiner optischen Geräte berühmt ist. Das rief bei den Kommissionsmitgliedern echtes Interesse hervor. Warum das denn? Plötzlich wurde die Runde lebhaft, man begann fantastische Vermutungen anzustellen. Aber es änderte nichts an dem Fakt: Japan hatte tatsächlich einen große Menge unserer Schulmikroskope gekauft und dafür mit konvertierbarer Valuta bezahlt. Die Neugierigsten unter den Kommissionsmitgliedern begannen sich für Lieferumfang und Stückkosten, umgerechnet in Rubel, zu interessieren. Leider taten sich die Mitarbeiter der Betriebs-Buchhaltung schwer, auf diese Fragen zu antworten. Sie verwiesen darauf, dass der Umtauschkurs sehr instabil und dies außerdem ein kommerzielles Geheimnis sei. Die Erwähnung der Geheimhaltung brachte die aktiven Kommissionsmitglieder in Verlegenheit und so verzichtete man darauf, weitere Fragen zu stellen.
Danach blieb mir nichts weiter übrig, als die Frage der Zuerkennung des Qualitätszeichens für das Mikroskop MS-1 zur Abstimmung zu stellen. Wie zu erwarten war, erfolgte diese einstimmig. Dann fand die feierliche Unterzeichnung der Schlussakte mit der entsprechenden Entscheidung der Staatlichen Evaluierungskommission statt. Unter dem Beifall aller Anwesenden wurde das Dokument dem Werkdirektor überreicht.
Der erfolgreiche Abschluss des offiziellen Teils unserer Mission wurde mit einem gemeinschaftlichen Essen begangen, das wegen seines hohe Niveaus, für das die Gastgeber gesorgt hatten, besonders in Erinnerung blieb. Ein Wermutstropfen war allein das Verhalten des Vertreters von Gosstandard. Sergej hatten die letzten Aufregungen doch sehr zugesetzt und deshalb vertrug er die hochprozentigen Getränke nicht so gut. Er begann mir plötzlich zu erzählen, dass tatsächlich für die Japaner unser Mikroskop völlig nutzlos sei. Sie kauften es aber wegen der Verpackungskästen, die aus einer teuren Holzart gefertigt waren, und die gab es eben nur auf der Krim. Diese Kästen brauchten sie für irgendwelche spezielle Zwecke. Ich nahm an, dass Sergej wahrscheinlich in beleidigter Stimmung war und deshalb so sprach. Ich hoffte nur, dass bei dem großen Lärm am Tisch seine Worte niemand außer mir gehört hatte.
Die nächsten Tage dienten im Wesentlichen dazu, die bei der gemeinsamen Arbeit entstandenen Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Kommission und den Werktätigen des Betriebes weiter auszubauen. Häufige kameradschaftliche Trinkgelage förderten dies sehr. Unsere Freundschaft festigte sich mit hochprozentigen Marken-Weinen und den in großer Zahl ausgebrachten Trinksprüchen. Gerechterweise muss man sagen, dass die Werktätigen des Betriebes, was die Standhaftigkeit bei solchen Gelagen anging, die Mitglieder unserer Kommission bei weitem übertrafen. Meine Lage als Vorsitzender blieb allerdings weiter recht kompliziert. Nach dem Reglement war ich weiterhin verpflichtet, im Namen der Kommission die meisten Reden zu halten und Trinksprüche auszubringen. Doch dafür musste ich wenigstens verhältnismäßig nüchtern bleiben. Diese kleinen Unannehmlichkeiten bemühte ich mich durch aktive Beteiligung am Kulturprogramm zu kompensieren. Von den vielen Veranstaltungen blieb mir besonders das Delfinarium in der Krim-Biostation im Gedächtnis. Irgendwie kam es mir vor, als ob die Delfine mit ihren akrobatischen Sprüngen und lauten traurigen Schreien zeigen wollten, dass sie die Situation verstünden, in der ich mich zufällig befand, und mir ihr Mitgefühl ausdrücken wollten. Ich war mir natürlich nicht sicher, ob dies wirklich in ihrer Absicht lag, doch ich war ihnen dennoch aufrichtig dankbar.
Einige Tage später, nach einem bewegenden Abschiedsabend, bei dem alle Kommissionsmitglieder Erinnerungs-Souvenirs erhielten, verabschiedeten wir uns von den gastfreundlichen Betriebsangehörigen und kehrten, bereichert durch angenehme Erinnerungen und neue Beziehungen, nach Hause zurück. Und mit Wolodja F. versöhnte ich mich gegen Ende der Kommissionstätigkeit wieder und wir blieben noch viele Jahre eng befreundet.
Nachwort
Damit war leider die oben erzählte Geschichte noch nicht zu Ende. Der Betrieb begann, angeregt durch diesen ersten Erfolg, immer wieder neue Produktionsmusterstücke zur Evaluierung zu beantragen. Daher wartete ich in den folgenden 5-6 Jahren, meist gegen Ende September, schon mit Unruhe darauf, dass mich der Prorektor zu sich rief und ich die übliche telegrafische Aufforderung bekam, mich für die Dienstreise zum optisch-mechanischen Werk N. zur Verfügung zu halten – und zwar gleich als Vorsitzender der Staatlichen Kommission. Gerechterweise muss man sagen, dass die Arbeit der folgenden Kommissionen (bei kaum veränderter Zusammensetzung) kürzere Zeit dauerte. Es gab keine Blumenschau mehr, und das Kulturprogramm sah im Vergleich zu unserem ersten Besuch viel bescheidener aus. Lediglich die Zahl der freundschaftlichen Tischgelage, die es – wie auch früher – auf „hohem Niveau“ gab, verringerte sich nicht erheblich. Das letzte Bankett anlässlich der Verleihung des Qualitätszeichens für ein ordentliches Erzeugnis fand, wenn ich mich nicht irre, zu Beginn der 80er Jahre statt. Die Stimmung aller Teilnehmer der Abschlussfeier war wie immer heiter und ausgelassen - und die Trinksprüche auf die Festigung der Freundschaft und das Gedeihen der Branche wollten anscheinend kein Ende nehmen.
Sergej, Vertreter von Gosstandard, der bisher still an seinem Platz gesessen hatte, erhob sich plötzlich von seinem Platz, um einen Toast auszubringen. Sofort verstummten die Gespräche am Tisch – in Erwartung dessen, was kommen sollte. Sergej erhob sein Glas und sagte: „Schon seit einigen Jahren verleihen wir das Qualitätszeichen für Geräte, die bei vielen Fachleuten Zweifel hervorrufen. Jedoch“, und dabei sah er mit finsterem Blick in meine Richtung, „überwinden wir solche Bedenken jedes Mal erfolgreich. Und das ist natürlich zweifelsohne das Verdienst unseres ständigen Vorsitzenden, dem wir dankbar sein können. Daher schlage ich vor, ihm jetzt ebenfalls das Qualitätszeichen zu verleihen.“ Ohne den versteckten Unterton des Trinkspruchs zu erfassen, stimmten alle anwesenden Kommissionsmitglieder und Betriebsangehörigen diesem Vorschlag begeistert zu und tranken auf das Wohl des Vorsitzenden der Evaluierungskommission.
Offensichtlich wurde dieser exotische „Beschluss der Kommission“ auf irgendeine Weise dem Ministerium zugetragen. Denn ich wurde zu weiteren Evaluierungen für das Qualitätszeichen nicht mehr eingeladen.
* Das „Qualitätszeichen“ wurde in der UdSSR am 20. April 1967 eingeführt und hatte das Ziel, die Effektivität der Produktion und die Qualität der Erzeugnisse zu erhöhen. Damit markierte man in der UdSSR hergestellte Waren mit ausgezeichneter Qualität. Das Recht auf dieses Qualitätszeichen erhielten die Betriebe von Staatlichen Kommissionen zugesprochen, die solche Waren evaluierten und deren Qualität einem Vergleich mit den besten ausländischen Mustern unterzogen. Die Evaluierungsbestimmungen wurden vom Amt für Standards, Mess- und Regelungstechnik beim Ministerrat der UdSSR festgelegt. Doch alle diese gutgemeinten Absichten, die von den Medien als großartige Sensation dargestellt wurden (wie es in der Sowjetunion üblich war!), verkehrten sich in bloße Augenwischerei und dienten lediglich dem Kampf der Obrigkeit um Prämien und Auszeichnungen. Infolgedessen verlor das Qualitätszeichen mit der Zeit völlig seinen Wert und wurde zu einem der sowjetischen Symbole, die zusammen mit dem Fall der Sowjetunion für immer verschwanden.
Potsdam, Oktober 2016
(Übersetzung aus dem Russischen ins Deutsche Konrad Geburek )
In jenem Zimmer
(Zur Geschichte eines Gedichts)
In den Jahren 1979 bis 1995 verbrachten meine Frau und ich fast jedes Jahr im August - September unseren Urlaub am Schwarzen Meer, und zwar in der Siedlung Koktebel (damals „Planerskoje“). Diese Gegend war uns von einem Arzt der Poliklinik als der für die Behandlung meiner chronischen Bronchitis am besten geeignete Ort empfohlen worden. Man kann sagen, dass wir nirgends, weder früher noch später, während unserer Reisen in der ehemaligen UdSSR und im Ausland einen solchen Ort vorfanden, wo eine so außergewöhnliche Atmosphäre herrschte, durchdrungen von einem besonders kreativen Geist – wo Irdisches und Kosmisches derart eng verflochten waren. Koktebel sind zahlreiche Kunstwerke gewidmet worden – Gedichte und Aquarelle von Maximilian Woloschin, Gemälde von Aiwasowski, literarische Werke von Bunin, Weresajew, Nagibin, Paustowski, Ehrenburg und vieler anderer, die von der Einzigartigkeit dieses wundervollen Winkels unseres Planeten begeistert waren.
Es ist keineswegs erstaunlich, dass Koktebel von jeher als ein beliebter Urlaubssort für Schriftsteller, Dichter und Künstler galt. Sie kamen hierher mit ihren Familien, um sich im „Künstlerhaus“, am Ufer der Koktebel-Bucht gelegen, zu erholen. Außerdem gab es in Koktebel noch eine Reihe von Sanatorien und Erholungsheimen. Aber für einen Normalsterblichen war es praktisch unmöglich, dort einen Platz zu bekommen. Daher entschlossen wir uns, ein Zimmer im sogenannten „Privatsektor“ zu suchen. Nach einigen erfolglosen Versuchen stießen wir zufällig auf ein Haus, wenn ich mich nicht irre, in der Scherschnjowstr. 31.
Hausherrin war die etwas beleibte, sehr freundliche Frau Maria Fjodorowna, die mit ihrem Mann Timofej Iwanowitsch (Tima) schon vor dem Krieg in Koktebel gelebt hatte. Auf einem für damalige Verhältnisse recht weitläufigen Grundstück, überreich in Grün gebettet und von Zypressen und blühenden Blumenbeeten geschmückt, erhob sich ein großes weißes Haus mit mehreren Zimmern und einer Küche. An der linken Seite grenzte das Grundstück an das Sommerhaus des damals berühmten Ballettmeisters Igor Moissejew, rechts schloss sich ein nicht allzu großer Hügel an, von dem ein Abhang zum Meer führte. Ein besonderer Vorzug des Grundstücks von Maria Fjodorowna bestand darin, dass sich von hier aus ein wunderbarer Blick auf die Koktebel-Bucht und den Berg Karadag, einen bereits in prähistorischen Zeiten erloschenen Vulkan, eröffnete. Regen und Wind hatten in einem Zeitraum von Jahrtausenden aus der erstarrten Lava malerische filigrane Figuren geschaffen, welche die Berghänge schmückten. Inzwischen waren sie von uraltem Gesträuch überwuchert, von hohem Gras bewachsen und stellenweise von dichtem romantischem Wald bedeckt.

Vom Frühjahr bis in den späten Herbst hinein war dieses Anwesen von zahlreichen Urlaubern belegt. Sie bewohnten das Haus, die Laube im Garten und die sogenannten „Wirtschaftsgebäude“. Am Morgen strömten alle zu ihren Stammplätzen am Strand oder sie begaben sich zu den kleinen Buchten, die sich in großer Zahl am Fuß des Karadag ausbreiteten. Abends kamen sie müde und von der Sonne gebräunt zurück. Man versammelte sich im Hof um einen langen Holztisch, gedeckt mit Tellern voller aromatischer Früchte und gekochter Muscheln, die man in den Buchten gesammelt hatte. Ehrlich gesagt, gab es manchmal auch ein paar Flaschen des berühmten Massandra-Weins. Die Abende vergingen bei emotionalen Diskussionen zu Tagesereignissen, Problemen des exotischen Lebens im Kurort oder Neuigkeiten von zu Haus. In der Regel kannte man einander gut, denn, wer einmal hier Urlaub machte, kam dann in fast jeder Saison wieder. Man wurde zum Mitglied einer großen Familie, die wir im Scherz den „Salon von Maria Fjodorowna“ nannten.
Für am besten eingerichtet galt das größte Zimmer im Haus, in dem gewöhnlich Familien mit ihren Kindern untergebracht waren – oder Urlauber, die sich untereinander schon von früher her gut kannten. Die übrigen Gäste belegten die kleineren Zimmer oder kamen in den „Sarajchiks“ unter, einer Art Schuppen, die sich auf dem Grundstück befanden. Meine Frau und ich bevorzugten für unseren Aufenthalt eine geräumige Laube mit zwei Betten und Nachttischen. Diese Laube befand sich im Garten unter riesigen alten Kastanien. Wir waren damals jung, und so erschien uns das Leben in einer Laube nach dem lauten Moskauer Alltag sehr gemütlich und romantisch. Wir liebten unsere Laube und wussten schon immer im Voraus, wo wir unterkommen würden.
Doch einmal, gegen Ende der Sommersaison, gab es einen unerwartet anhaltenden Starkregen. Die Folge war, dass sich die Zahl der Urlauber auf dem Hof von Maria Fjodorowna sehr schnell reduzierte. So bot sie uns das große Zimmer an, das freigeworden war. Offen gesagt, uns erschien zu diesem Zeitpunkt das Leben in der Laube bei dem nicht nachlassenden Regen keineswegs mehr romantisch, im Gegenteil, es wurde immer ungemütlicher. Deshalb nahmen wir, ohne lange nachzudenken, das Angebot der Hausherrin an und zogen in das neue Quartier um.
Auf den ersten Blick machte das Zimmer einen recht ärmlichen und ungemütlichen Eindruck. Ein bisschen wurde es lediglich von einem an der Wand hängenden kleinen Bild mit einem einfachen Rahmen belebt. Darauf war eine Reiterin auf einem weißen Pferd dargestellt. Ich bin von früher her ein Pferdeliebhaber und so bemerkte ich sofort, dass dieses Pferd einen unproportioniert kleinen Kopf hatte und auch seine Beine nicht richtig gemalt waren. So machte das Bild, im Ganzen gesehen, keinen besonderen Eindruck auf uns. Wir hielten es für Kitsch und wandten uns der Aufgabe zu, ein wenig Ordnung zu schaffen und das Zimmer in einen mehr oder weniger annehmbaren Zustand zu bringen. Gegen Abend wurden wir langsam müde und beschlossen uns ein bisschen hinzulegen, um uns von den Anstrengungen zu erholen.

Doch unvermutet schien mich etwas zu stören: in meinem Kopf kreiste irgendetwas – wie eine kaputte Schallplatte – mit einem immer wiederkehrenden Refrain: „In jenem Zimmer..., in jenem Zimmer..., in jenem Zimmer...“ Und plötzlich tauchten in meinem Gedächtnis die Zeilen eines längst vergessenen Gedichts auf – lyrische und gleichzeitig philosophische Zeilen, die ihrer Musikalität und der malerischen Details wegen so anziehend auf mich wirkten.
In jenem Zimmer
In jenem Zimmer duftete es vom Fußboden her nach Wermut -
und nach einem Fluss, der Kühle in der Hitze bringt,
Und eine Lampe, die ohne Schirm an einem kalkgrauen Kabel hing,
schämte sich nicht, ihre Blöße zu zeigen.
Armut verteidigte sich hier durch Reinlichkeit.
Weißgetünchte, ein bisschen blau schimmernde Wände
schienen zu warnen: „Pass auf!
Wir könnten dich beschmutzen.“
Von den Urlauberinnen aus der „Hauptstadt der Welt“*
ging eine leichte „weltliche“ Trägheit aus,
aber das Zimmer hat sich gar nicht verändert
und sein altes Antlitz beibehalten.
Und wie ein Kind der Wirtin düster blickte
durchs Fenster auf das Durcheinander
von Flakons, Badeanzügen und Kämmen
mit gutmütiger Überlegenheit der Berg Karadag.
Und Frauen brachten einen Imbiss
einem Schatten entgegen, der in der Tür erschien.
Und ein durchsichtiger, feuchter Käse bewahrte
die netzartigen Spuren von der abgenommenen Gaze.
Ich war jener Schatten in den handgewebten Vorhängen.
Ich hörte hier das ausgetrocknete Büfett knarren,
Champagnerbläschen in Plastikbechern,
und Schmetterlinge, die drängten an das Licht.
Und an einer Wand, ein wenig geneigt,
„schwamm“ ein Bild in Öl auf Wachstuch,
gekauft, offensichtlich, für ein paar Groschen:
ein Kind des Marktes und ein Kind der Seele.
Dort war eine Art von Villa oder Tempel zu sehen.
Und vor dem Hintergrund von fernen Jachten auf einer Welle
als Chrysantheme erblühte eine Dame,
ganz in Rosa, auf einem weißen Reitpferd.
War der Künstler zu naiv oder allzu kühn?
Denn über dem sich kräuselnden Meer
malte er einen Baum in voller Blüte,
doch den andern machte er wie aus Gold.
Den Künstler vernichtet der Markt nicht,
egal, ob die Preise für seine Werke steigen oder fallen,
solange er denken kann, dass gleichzeitig
Herbst und Frühling möglich wären.
Und ganz ein Welken und ein Blühen,
ganz aus Falten, Muttermalen und Augen -
die Ursache für das Erscheinen meines „Schattens“ -
eine Bewohnerin war erstaunt und berührt.
Und sie schaute auf das Bild,
außerhalb der Zeit, außerhalb von Schmerz und Leid,
als ob sie versuchte das Echo zu vernehmen
von „in Luft gemalten“ Pferdehufen.
Alle Frauen sind in ihrem Herzen provinziell.
Ihr hauptstädtisches Benehmen ist nicht ernst gemeint.
Ändert sich ihre Umgebung, ist kein Prophet in der Lage,
den Gang der Verwandlungen vorherzusehen.
Doch die Erfahrung selbst lässt sich nicht vergessen.
Und schmunzelnd, mit einer Zigarette in der Hand, sagte sie:
„Ich, Dummerchen, dachte in der Kindheit, dass
Voll- und Halbmond gleichzeitig am Himmel leuchten können.“
Ich verlor auch das Kind in mir.
„Aber sei nicht so düster und bewirke ein Wunder,
du, meine Poesie: du bist mein Wachstuch -
auch das Kind des Marktes und das Kind der Seele!“
Und das Zimmer bekreuzigte wie eine Bäuerin
schattenhaft, mit Fingern wie im Halbschlaf,
jenes Fräulein, die kein Wäschewaschen kannte,
ganz in Rosa, auf dem weißen Reitpferd.
Und in den verschiedenen Fenstern des Zimmers
schwebten gleichzeitig der volle und der halbe Mond,
und an den Fensterläden kratzten mit den Zweigen
zur selben Zeit Herbst und Frühling.
Und die Träume trugen das Zimmer in die Ferne.
Vom Wachstuch sprang ins Zimmer die Brandung,
und das Zimmer glaubte so dem Bild,
dass es ohne dieses nicht dasselbe wäre.
(Freie Übertragung aus dem Russischen ins Deutsche Konrad Geburek)
Ja, in der Tat, eben diesem Zimmer und dem darin hängenden Bild war ein Gedicht meines Lieblingslyrikers Jewgeni Jewtuschenko gewidmet, das er vor langer Zeit, im Jahr 1969, geschrieben hatte! In jenem Sommer verbrachte er seinen Urlaub im „Künstlerhaus“ in Koktebel. Er hatte die Bekanntschaft einer Urlauberin von „unserem Hof“ gemacht und kam zu Besuch in „jenes Zimmer“. Und dort sah er in dem auf den ersten Blick primitiven Bild sofort etwas, was ihn dazu inspirierte, dieses lyrisch-philosophische Stegreifgedicht zu schaffen.
Jewgeni Jewtuschenko begegnete ich einige Male in Moskau. Ich bemühte mich, bei all seinen Auftritten dabei zu sein. In den 60er-70er Jahren – wie lange ist das schon her! – waren Treffen der Lyriker mit ihren Fans sehr populär. Diese Veranstaltungen fanden in Instituts- und Betriebssälen, auf öffentlichen Plätzen und sogar in Stadien mit über tausend Plätzen statt. Es galt als eine große Glücksache, wenn man eine Eintrittskarte für diese Treffen ergattern konnte, und längst nicht allen Interessenten gelang dies. Bei einem solchen Treffen, das im großen Saal der Moskauer Timirjasew-Akademie stattfand, hörte ich zum ersten Mal diese Verse über „jenes Zimmer“, in dem wir viele Jahre später für ein paar Tage Obdach fanden.
So hatte sich rein zufällig und unvermutet noch einmal ein Treffen mit dem Dichter, den ich immer sehr verehrte, ergeben, diesmal „in absentia“. Es war für mich, um es mit Boris Pasternaks Worten zu sagen, „des Schicksals Schnittpunkt“. Lesen Sie noch einmal dieses Gedicht und würdigen Sie selbst die Wahrnehmung des „Kitsch-Bildes“ durch den Dichter. Was mich betrifft, so höre ich bis heute nicht auf, das Talent des Künstlers zu bestaunen, seine Fähigkeit, in einfachen und gewöhnlichen Dingen etwas Verborgenes und Tiefes zu entdecken, an dem wir häufig vorübergehen, ohne darauf aufmerksam zu werden. Was unserem getrübten Alltagsblick verborgen bleibt, ist denen nicht zugänglich, die des „göttlichen Funkens“ entbehren.
______________________________
*gemeint ist Moskau (Anm. des Übersetzers)
(Übersetzung aus dem Russischen ins Deutsche Konrad Geburek)
Wie ich zum ersten Mal im „Westen“ landete
Der Anfang dieser Geschichte geht auf die Zeit der „Perestroika“ in der UdSSR zurück, die mit Michail Gorbatschow begann. Die zahlreichen Veränderungen im gesellschaftlichen Leben betrafen auch die Wissenschaft. Besonders von den Wissenschaftlern – ausgenommen waren die Grundlagenforscher – wurde erwartet, dass sie dem Staat nicht länger auf der Tasche liegen, sondern selber anfangen sollten, ihr Geld selbstständig zu verdienen.
Dieser Beschluss hatte in einer Reihe von Fällen ziemlich überraschende Folgen. Viele Professoren und Doktoren, unter anderem auch an unserer Timirjasew-Akademie, verstanden die Einführung der Marktwirtschaft wörtlich und stürzten sich, den Anweisungen der Partei entsprechend, auf den Markt. Sie begannen, Stecklinge von Obstbäumen und Sträuchern zu verkaufen, die man auf Versuchsfeldern gezüchtet hatte. Das betraf auch Gemüsesetzlinge und Blumenpflanzen. Man bot Fischzüchtern wertvolle Jungbrut an – natürlich zum Marktpreis. Großen Erfolg genossen bei Privateigentümern auch neue Technologien in der Bienenzucht, Gartengeräte und Anleitungen für die Arbeit auf Datschengrundstücken.
Wie Pilze nach dem Regen schossen an den Instituten der Akademie plötzlich Service-Laboratorien aus dem Boden, die gegen entsprechende Bezahlung die Qualität von Milch- und Fleischprodukten der Kolchosen und Sowchosen analysierten oder sich mit der Herstellung von Mikrobenkulturen zur Käseproduktion etc. beschäftigten.
Die geschäftstüchtigsten wissenschaftlichen Mitarbeiter verließen die Akademie und Institute, übernahmen die Leitung von Möbelgeschäften oder organisierten verschiedene Service-Einrichtungen und Wohnungsgenossenschaften. Überhaupt begannen alle, sich umzustellen und so auf die Perestroika einzulassen.
In dieser Zeit beschäftigte ich mich zusammen mit den anderen Mitarbeitern unseres Labors mit der Bekämpfung von Krankheiten neugeborener Kälber. Das war damals ein ziemlich aktuelles Problem, und wir erzielten schon einige Erfolge. Doch niemand von uns hatte eine Idee, wie man unsere Ergebnisse in bares Geld verwandeln konnte. Der einzige Versuch in dieser Richtung war eine von uns herausgegebene Broschüre mit dem Titel „Kälberaufzucht“, die wir für Eigentümer von Gutswirtschaften vorgesehen hatten. Doch diesem Handbuch war kein großer Erfolg beschieden.
Irgendwann entstand der Gedanke, mit unseren Leistungserfolgen die internationale Arena zu betreten. Unser Interesse galt in erster Linie den Ländern, in denen die private Tierzucht intensiver entwickelt war als in der UdSSR. Dabei kamen wir auf die mit uns freundschaftlich verbundene DDR, die uns in dieser Beziehung am aussichtsreichsten erschien. Ihre Erfolge auf diesem Gebiet waren hinläglich bekannt. Außerdem hatten einige von uns schon in der Schule Deutsch gelernt. So nutzten wir die bereits vorhandenen wissenschaftlichen Beziehungen zum Lehrstuhl für angewandte Tierzucht der Humboldt-Universität Berlin, wo sich die Kollegen mit einer analogen Thematik beschäftigten. Daher beschlossen wir, ihnen vorzuschlagen, unsere Anstrengungen im Rahmen eines gemeinsamen Projekts zu vereinen.
Man muss sagen, dass diese Idee sofort die volle Zustimmung von oben fand. Die Leiter unserer Akademie fuhren bald darauf nach Ost-Berlin, um mit der Universitätsleitung Fragen zur Realisierung des gemeinsamen Projekts zu klären. Das Treffen verlief, wie man später berichtete, erfolgreich und auf „sehr hohem Niveau“. Es wurde eine Menge hochprozentiger Getränke konsumiert – und man brachte viele Trinksprüche auf den Erfolg der Zusammenarbeit und auf die Freundschaft zwischen unseren Völkern aus.
Allem Anschein nach hatte die Reise der Leitung gefallen und so plante man neue Treffen. Diese Reisen waren mit der Zeit so häufig geworden, dass von unserem Ministerium die Entscheidung gefallen war, die Zahl der Auslands-Dienstreisen unserer Verwaltungschefs zu beschränken. Diese Leute sahen nämlich das Ziel ihrer Reisen im Grunde nur in der „Festigung der Freundschaft und des Friedens in der ganzen Welt“. Es wurde nun empfohlen, auf diese Dienstreisen die einfachen wissenschaftlichen Mitarbeiter zu schicken, die sich auch unmittelbar praktisch an den gemeinsamen Forschungsprojekten beteiligen konnten.
Als ich von dieser Entscheidung erfuhr, beschloss ich, unverzüglich meine Deutschkenntnisse aufzufrischen und, wie man damals sagte, zu „vertiefen“. Aber wie? Die Hilfe erschien – wie so oft – von unerwarteter Seite. An das Institut für Ökonomie unserer Akademie war eine Studentin aus der BRD gekommen, um ihre Diplomarbeit zu schreiben. Nennen wir sie Luzi. Das Thema ihrer Arbeit war die Entwicklung der Ökonomie in der UdSSR unter den Bedingungen der „Perestroika“. Als Material sollten ihr Artikel aus der sowjetischen Presse dienen, die sich dem Übergang der Ökonomie der UdSSR zur Marktwirtschaft widmeten.
Doch bei der Umsetzung ihrer Pläne tauchten plötzlich zwei Probleme auf. Das erste bestand darin, dass Luzi nur über – gelinde gesagt – schwache Russischkenntnisse verfügte. Es war für sie sehr anstrengend, mit Hilfe des Wörterbuches den Inhalt dieses oder jenes Artikels zu übersetzen und zu verstehen. Dies raubte viel Zeit und machte ihre Arbeit wenig produktiv. Der mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit verbundene Stress verstärkte sich noch, als Luzi sich plötzlich bis über beide Ohren in einen afrikanischen Studenten verliebte, der damals an der Moskauer Patrice- Lumumba-Universität der Völkerfreundschaft studierte. So erwies sich die Moskaureise Luzis zumindest in dieser Beziehung als gelungen – und ermöglichte auf alle Fälle neue Erfahrungen.
Das erste Problem Luzis (mit ihrer Diplomarbeit) konnte mit meiner Hilfe gelöst werden. Ich erklärte mich bereit, alle in unserer Presse erscheinenden ökonomischen Artikel zu lesen und für sie ein Resümee in Deutsch zu erstellen. Hierfür sollte sie im Geiste der neuen Marktwirtschaft einen symbolischen Preis zahlen: ein Resümee – ein Dollar.
Das war eine außerordentlich vorteilhafte Übereinkunft für beide Seiten. Luzi konnte jetzt einen Großteil der Zeit ihren persönlichen Belangen widmen – und ich verbesserte meine Deutschkenntnisse und bekam obendrein dafür noch eine Belohnung in Valuta. Wobei dieser Betrag unter den damaligen Verhältnissen schon sehr hoch war. So konnte man zum Beispiel den damals für Normalsterbliche unerreichbaren Wagen Wolga ohne jede Warteschlange für insgesamt 1250 Dollar kaufen.
Gerechterweise muss man sagen, dass ich diese Dollars nicht gerade leicht verdiente, zumal meine Deutschkenntnisse noch zu wünschen übrig ließen und mir die ökonomische Terminologie kaum geläufig war. Sogar wenn ich im Urlaub auf die Krim fuhr, schleppte ich Wörterbücher und einen Haufen von Zeitungsausschnitten mit – und versuchte, den Urlaub am Meer mit der Entwicklung der Marktwirtschaft in der UdSSR zu verbinden.
Jedoch wurde letzten Endes das gesteckte Ziel erreicht. Mein Deutsch verbesserte sich wesentlich. Und als im Rektorat die Frage nach den Kandidaten für eine Reise in die DDR aufkam, war ich unter den Ersten, die für die Arbeit an dem gemeinsamen Projekt vorgesehen wurden. In der üblichen Weise instruierte man mich im Rektorat sowie im Parteibüro und Institut. Sehr schnell wurden in der internationalen Abteilung der Akademie – nachdem ich eine ganze Menge verschiedenster Papiere zusammengetragen hatte – die entsprechenden Dokumente ausgestellt. Und nach zwei Wochen erhielt ich das langersehnte Visum.
Ich eilte nach Hause und packte schnell den Koffer mit den Sachen, mit Fachbüchern, verschiedenen Kleinigkeiten und Geschenken für die deutschen Freunde. Am nächsten Morgen saß ich schon im Dreierabteil des Expresszuges Moskau – Berlin.
Die Reise verlief im Ganzen normal. Allerdings gab es einen kleinen „Zwischenfall“ an der sowjetisch-polnischen Grenze. Es war nämlich so, dass meine Frau mir für alle Fälle eine Rolle Toilettenpapier in den Koffer gelegt hatte. Als an unserer Grenze die Zollbeamten erschienen, rief diese Rolle bei ihnen zunächst Erstaunen hervor, was dann aber schnell in professionelle Verdächtigung überging. Sie baten meine Mitreisenden, das Abteil zu verlassen und wickelten die verdächtige Rolle ab, weil sie nach verbotener Valuta suchten. Den Gesichtsausdruck meiner Mitreisenden, die nach Beendigung der Kontrolle in das mit lauter Toilettenpapier angefüllte Abteil zurückkamen, erspare ich mir zu beschreiben.
Die weitere Reise verlief ohne Vorkommnisse und am Abend des nächsten Tages erreichte der Zug den Ostbahnhof in Berlin. Ich wurde von einem Mitarbeiter der Universität abgeholt. Er brachte mich ins Gästehaus, das sich neben der U-Bahn-Station „Tierpark“ befand, zwanzig Minuten vom Zentrum entfernt. Dort traf ich zu meiner Freude einen Bekannten, den Professor N. W., Leiter des Lehrstuhls für Ökonomie an unserer Akademie. Er war ein paar Tage früher zu einem Arbeitsbesuch an der Universität eingetroffen. Wir verbrachten in diesem Hotel einige Tage zusammen und diskutierten angeregt die stürmischen Ereignisse in Deutschland in diesen heißen Junitagen des Jahres 1990.
Im Mai (18.05.1990) war in Bonn der Vertrag über die Errichtung eines einheitlichen Wirtschaftsraumes in Deutschland unterzeichnet worden. Ab 1. Juli 1990 brachte man auf dem Territorium der DDR die D-Mark (BRD) in Umlauf, während die Ostmark abgeschafft wurde. Die Berliner Mauer existierte noch, man hatte jedoch den Stacheldraht bereits entfernt und an vielen Stellen war die Mauer bereits durchbrochen. An der früheren Grenze entlang waren Kontrollpunkte eingerichtet worden, über die alle, die es wollten, ungehindert von Ost- nach West-Berlin und umgekehrt gelangen konnten. Sie mussten lediglich ihren Pass vorzeigen. Übrigens wurde auch der Touristenstrom von West nach Ost immer intensiver.
Einer der Gründe dafür war außer schlichter Neugier die Marktwirtschaft, über die wir bereits sprachen. Es war nämlich so, dass in den ersten Julitagen alle in der DDR produzierten Waren aus den Geschäften verschwinden und durch BRD-Waren ersetzt werden sollten. So entsprach es dem Plan der Wiedervereinigung Deutschlands. Hierbei wurden die Preise für DDR-Waren mit jedem Tag weiter herabgesetzt, was dazu führte, dass sie sich einer immer größeren Nachfrage bei den West-Touristen erfreuten.
Das Ergebnis war, dass die Kaufkraft der Ostmark im Verhältnis zur D-Mark kräftig anzuwachsen begann. Der Tauschkurs zwischen beiden Währungen regulierte sich an der spontan entstandenen „internationalen Börse“ in Berlin – Alexanderplatz. Daran beteiligten sich aktiv außer den Deutschen auch Polen, Türken, Vietnamesen und sogar die in der DDR früher selten zu beobachtenden Bewohner ferner afrikanischer Länder. Es war nicht ausgeschlossen, dass unter ihnen vielleicht auch aus Moskau angereiste Studenten der Universität der Völkerfreundschaft sein könnten, die in der Praxis den Mechanismus der Marktwirtschaft studieren wollten, von der sie so viel in der UdSSR gehört hatten.
Halbstündlich wurde in diesen heißen Junitagen des Jahres 1990 an der „Börse“ der aktuelle Umtauschkurs bekanntgegeben, der immer wieder eine neue Welle der Geschäftsaktivität auslöste. Sie erreichte ihren Höhepunkt, als das Verhältnis der DDR-Mark zur D-Mark sich erstmals anglich und dann die DDR-Mark sogar den Wert der D-Mark übertraf. Das waren goldene Zeiten für die Spekulanten aller Couleur, die zum Teil riesige Gewinne anhäuften. Die Angehörigen der „tapferen Sowjetarmee“, die in der DDR stationiert waren, blieben ebenfalls von diesem spannenden Prozess nicht unberührt. Eine Folge davon war, dass die Militärtransporte aus der DDR in östlicher Richtung ständig zunahmen.
Ein seltsames Bild gaben in diesen Tagen die Verkaufsläden der DDR ab. Die Waren verschwanden schnell und mit ihren leeren Regalen ähnelten sie mehr und mehr den Geschäften in der UdSSR. Lebensmittel, Kleidung, Geschirr, Kosmetikartikel, Radio- und Fernsehgeräte – alles wurde aufgekauft und in Kästen und Säcken weggetragen. Daran beteiligten sich alle Gruppen der Bevölkerung, in erster Linie Rentner. Ich konnte oft beobachten, wie bejahrte Omas versuchten, schwere Schachteln mit verschiedenen Waren in ihre Wohnungen zu schleppen.
Vor den Sparkassen und Banken Ost-Berlins bildeten sich riesige Schlangen, die mich an die Schlangen am Lenin-Mausoleum in Moskau erinnerten. Die DDR-Bürger beeilten sich, ihre Ersparnisse in D-Mark umzutauschen, die in einigen Tagen in Umlauf kommen sollten. So standen die Leute „rund um die Uhr“. Insgesamt muss man sagen, dass der Abschied der DDR-Bürger von ihrer Republik, die doch vor Kurzem noch ihren 40. Jahrestag feierte, in einer euphorischen Atmosphäre, gemischt mit gesteigerter Betriebsamkeit, vonstattenging.
Als ich einmal abends nach der Arbeit vom Institut ins Hotel kam, traf ich meinen Nachbarn, den Professor, in einer äußerst gereizten Stimmung an. Nachdem er sich ein wenig beruhigt hatte, erzählte er mir von den Ereignissen dieses Tages. Am Morgen hatte er sich in der Hotelhalle mit einem Mitarbeiter und einer Dolmetscherin von der Westberliner Universität getroffen, die ihn zur Uni begleiten sollten, denn er war von der Leitung des Ökonomie-Lehrstuhls eingeladen worden.
Gemeinsam hatten sie sich zum Grenz-Kontrollpunkt am Brandenburger Tor begeben. Nachdem sie ihre Pässe vorgezeigt hatten, wollten sie nach West-Berlin durchgelassen werden. Die Dokumente der Begleiter des Professors keinerlei Fragen bei den Polizisten hervor, doch als sie den roten Sowjet-Pass des Professors erblickten, änderte sich ihr Gesichtsausdruck, und sie erklärten der Dolmetscherin, dass sie den Professor nicht durchlassen könnten. Auf seine erstaunte Frage, weshalb allen anderen dieses Recht gewährt würde, nur ihm nicht, zeigten die Polizisten ein offizielles Papier, auf dem auf Russisch und Deutsch etwa Folgendes geschrieben stand: „Die Botschaft der UdSSR in der DDR ersucht im Namen der sowjetischen Regierung die Organe der DDR, keine Personen mit sowjetischer Staatsbürgerschaft nach West-Berlin passieren zu lassen, um mögliche Provokationen zu vermeiden.“
„Was soll ich denn nun tun?“ fragte der unglückliche Professor. Einer der Polizisten zuckte mit den Achseln und riet ihm, sich um Aufklärung an die Sowjetische Botschaft zu wenden. Der Professor beschloss, sich umgehend dorthin zu begeben und versprach, die Mitarbeiter der Universität später über das Ergebnis des Besuchs zu informieren. In der Botschaft, die sich in der nahegelegenen Straße „Unter den Linden“ befand, empfing ihn irgendein verantwortlicher Mitarbeiter. Nachdem er den Professor mit seinem Problem angehört hatte, atmete er erleichtert auf und sagte, dass diese Angelegenheit nicht in seiner Kompetenz läge und er verwies ihn an ein anderes Kabinett. Das Gespräch dort verlief ebenso ergebnislos, allerdings empfahl man ihm, sich an den Kultur-Attaché zu wenden. Der hörte aufmerksam den schon etwas genervt vorgetragenen Bericht an und schaute dabei nachdenklich aus dem Fenster. Nach einer Pause fragte er dann: „Sagen Sie, sehr verehrter N. W., steht in Ihrem Dienstreise-Auftrag etwas von einem Besuch der Universität in West-Berlin?“ Der Professor sah sich gezwungen zuzugeben, dass es einen solchen Punkt tatsächlich nicht gäbe. „Na, sehen Sie“, sagte der Attaché und breitete theatralisch seine Arme aus, „den Punkt gibt es nicht – also, was wollen Sie denn?“ – „Ich wollte“, erklärte der Professor, „auf Einladung der Kollegen dieser Universität, mit der wir schon seit langem wissenschaftliche Beziehungen unterhalten, die Thematik ihrer Arbeiten auf dem Gebiet der angewandten Ökonomie kennenlernen. Viele Themen, an denen sie arbeiten, berühren Themen, die auch uns interessieren.“ „Doch ein Besuch in West-Berlin ist in Ihrem Arbeitsplan nicht vorgesehen“, äußerte der Botschaftsattaché erneut, „das bedeutet, Ihre Bitte ist unbegründet.“
Der Professor verstand, dass es sinnlos war, das Gespräch fortzusetzen. Er sagte: „Formal gesehen mögen Sie recht haben. Nur verstehen Sie, wenn ich nach Moskau zurückkomme, dann wird es mir sehr schwerfallen, unseren Studenten an der Akademie zu erklären, weshalb heutzutage Bürger eines jeden beliebigen Landes West-Berlin freizügig besuchen können, dies aber einem sowjetischen Professor verwehrt ist.“ Er stand hastig auf und, ohne sich zu verabschieden, begab er sich zur Tür. „Warten Sie, warten Sie, regen Sie sich nicht so auf!“ hielt ihn der Attaché zurück. „Warum führen Sie sich so auf? Wenn dies für Sie wirklich so wichtig ist, dann machen wir es so: Die Kollegen schreiben einen offiziellen Brief an unsere Botschaft, in dem Sie eingeladen werden, ihre Universität zu besuchen. Hierbei ist es unbedingt erforderlich, das Datum und die genaue Zeit anzugeben, also, wie lange dieser Besuch dauern wird...“
Daraufhin wandte sich die Universitätsverwaltung mit einem Brief an die Botschaft der UdSSR, der die offizielle Einladung enthielt. Danach bekam der Professor ein Dokument von der Botschaft, in dem genauestens festgelegt wurde, dass ihm am ... in der Zeit von ... bis … Uhr die Einreise nach West-Berlin zur Teilnahme an einer wissenschaftlichen Konferenz gestattet sei. (Die Konferenz war eigens zu diesem Zweck erfunden worden – Anm. N. E.)
Als N. W. am Abend desselben Tages nach Hause kam, zeigte er mir voller Stolz den „Sonder-Passierschein“, der auf einem mit Wasserzeichen versehenen Botschaftsformular gedruckt und mit dem Wappen der UdSSR geschmückt war. N. W. erklärte mit nicht wiedergabefähigen Ausdrücken, dass er dieses einzigartige Dokument für für die Geschichte aufbewahren werde.
Meiner Ansicht nach lässt diese Geschichte tief blicken. Jedenfalls lösten unsere Touristen, die sich in diesen Tagen in der DDR-Hauptstadt aufhielten, das Problem eines West-Berlin-Besuchs sehr viel einfacher. Um das touristische Interesse unserer Landsleute zufriedenzustellen, boten zahlreiche in der BRD lebende russische Emigranten – sie hatten die UdSSR in den 70er Jahren verlassen – ihre Dienste als „Reiseführer“ an. Außerdem gab es auch Angehörige der Sowjetarmee (in Zivil), die sich gut in dieser Gegend auskannten. Es war überhaupt nicht schwierig. Die Berliner Mauer wurde zu dieser Zeit immer durchlässiger. So schleusten die „Reiseführer“ unsere wissbegierigen Touristen (natürlich gegen Bares) über die Grenze und ermöglichten einen Ausflug in den streng verbotenen kapitalistischen Westen.
Ehrlich gesagt, auch ich wollte West-Berlin sehen, von dem ich schon so viel gelesen und gehört hatte. Meine Dienstreise zur Humboldt-Universität ging bald zu Ende. Und so beschloss ich – ein wenig zu unbedacht – diesen Wunsch meiner Betreuerin im Institut, Katharina Z., mitzuteilen. Als sie das hörte, fiel sie fast in Ohnmacht und nahm mir das „eidesstattliche“ Versprechen ab, nicht dem Beispiel unserer Touristen zu folgen und „illegal“ zu versuchen, in diesen schrecklichen Westen vorzudringen. Was blieb mir übrig? Natürlich musste ich es ihr versprechen.
Aber ich will ehrlich bekennen: der Gedanke, West-Berlin wenigstens mit „halbem Auge“ zu sehen, verließ mich nicht. Um so mehr, weil es nur ein Katzensprung war! Das Uni-Institut, an dem ich arbeitete, befand sich in der Invalidenstraße, ungefähr 100 Meter von der Grenze zu West-Berlin entfernt. Jeden Tag sah ich auf dem Weg von und zur Arbeit den mit Metallzäunen abgesperrten Grenzübergang, wo immer zwei Polizisten standen, die den Menschenstrom in beide Richtungen regulierten.
Aber einmal, als ich am Ende des Tages nach Hause zurückkehrte, sah ich, dass die Polizisten irgendwohin verschwunden waren. Eine unwiderstehliche Kraft zog mich in Richtung Kontrollpunkt. Ungehindert überschritt ich ihn, doch nach etwa 20-30 Metern kam mir mein Versprechen, das ich Katharina Z. gegeben hatte, in den Sinn – und ich blieb unschlüssig stehen. In diesem Moment kamen die beiden Polizisten an ihren Platz zurück. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, und so beschloss ich, es sei wohl besser, in meine „Zone“ zurückzugehen. Aber wie sollte ich dies anstellen? Ich ging auf die Polizisten zu und fragte sie mit unschuldiger Miene, wo sich die Abteilung der Humboldt-Universität befinde, in der ich arbeitete. Sie zeigten in Richtung „meiner Zone“. Und da kam mir der Gedanke, wie ich doch nach West-Berlin gelangen konnte, ohne gegen mein Katharina Z. gegebenes Wort zu verstoßen und nicht „illegal“ zu handeln.
Ich wandte mich an die Polizisten: „Sagen Sie bitte, kann ich nicht ein bisschen West-Berlin sehen?“ „Natürlich“, antworteten mir die beiden. „Sie sind ja bereits in West-Berlin!“ „Leider kann ich dies nicht ohne Erlaubnis tun.“ „Warum?“ staunten die Polizisten. „Weil ich – und ich erinnerte mich an die Abenteuer des Professors – weil ich einen sowjetischen Pass habe.“ Die Polizisten lachten freundlich und gaben mir zu verstehen: Bitte sehr, gehen Sie und schauen Sie sich um! Ich traute meinem Glück noch nicht und fragte: „Wie lange haben Sie heute Dienst?“ „Wir werden in etwa einer Stunde abgelöst.“ „Gut, das schaffe ich!“ Ohne ihre Antwort abzuwarten, stürzte ich Hals über Kopf los und lief entlang der Invalidenstraße in den Westen. Dabei schaute ich immer wieder auf die Uhr. In etwa 25 Minuten schaffte ich es bis zur nächsten S-Bahn-Station, „Lehrter Bahnhof“. Dort blieb ich stehen, um erst einmal Luft zu holen. Ich verstand, dass meine Zeit knapp wurde, und so kehrte ich um, kaufte an irgendeinem Kiosk ein paar Büchsen Bier für die Polizisten und erreichte pünktlich „meinen“ Kontrollpunkt.
Die Polizisten dankten mir freundlich für das Bier. Sie sprachen ein paar Worte Russisch, die sie wahrscheinlich noch von der Schule her kannten, und bemühten sich nun, ihre Kenntnisse in einem Gespräch mit mir anzuwenden. Denn sie wollten gern wissen, wie es mir bei meiner „Exkursion in den Westen“ ergangen war. „Toll war es, aber viel zu kurz“, sagte ich mit einem Seufzer. „Dann kommen Sie doch morgen wieder, da können Sie den ganzen Tag dort spazieren gehen.“ - „Und haben Sie morgen auch wieder Dienst?“ - „Nein, aber wir sagen unserer Ablösung Bescheid, damit die Sie durchlässt. Werden Sie wieder diese weiße Baseballmütze tragen?“ - Ich nickte bestätigend mit dem Kopf, verabschiedete mich von den sympathischen Polizisten und „flog“ geradezu hoffnungsvoll nach Hause.
Am nächsten Tag kam ich frühmorgens in mein Institut und meldete mich unter irgendeinem Vorwand für den ganzen Tag ab, um persönliche Angelegenheiten zu klären. Nachdem ich die Erlaubnis dazu bekommen hatte, begab ich mich im Laufschritt zur Kontrollstelle Invalidenstraße und dachte darüber nach, wie ich den Polizisten unsere gestrige Abmachung erklären würde. Als ich mich dem Kontrollpunkt näherte, sah ich, dass dort zwei Polizisten standen, die lebhaft mit zwei Personen in Zivil sprachen. Ich wusste nicht, wie ich mich in dieser Situation verhalten sollte, daher verlangsamte ich instinktiv meine Schritte. Aber die Entfernung zwischen dem Kontrollpunkt und mir verringerte sich unerbittlich und gleichzeitig wuchs das Gefühl von Angst und Hilflosigkeit.
Plötzlich wandte sich einer der Polizisten in meine Richtung, sah mich und schwenkte einige Male den Arm – quasi wie eine Geste, mit der Verkehrspolizisten Kraftfahrer zu schnellerer Weiterfahrt aufforderten. Ich ließ mich nicht lange nötigen, vergaß sogar die Polizisten zu grüßen und flog wie der Blitz durch den Kontrollpunkt. Bald erreichte ich die mir schon bekannte U-Bahn-Station „Lehrter Bahnhof“, dort nahm ich die S-Bahn und stieg nach 5 Minuten an der Station „Zoologischer Garten“ aus – und war im eigentlichen Zentrum West-Berlins.
Ein heißer Tag hatte begonnen, hell schien die Sonne und in ihrem Glanz erblickte ich eine vollkommen andere Welt, von der ich so viele interessante, widersprüchliche, doch bisweilen auch schreckliche Geschichten gehört hatte.
 Ich ließ den Bahnhof hinter mir zurück und fand mich auf der bekannten Hauptstraße West-Berlins wieder – dem Ku'damm. Auf dem Platz, wo diese Straße ihren Anfang nimmt, erhebt sich das in aller Welt bekannte Symbol West-Berlins – das im Herbst 1943 bei einem Bombenangriff der Alliierten zerstörte Gebäude der Gedächtniskirche, deren Ruine als Mahnmal zur Erinnerung an den 2. Weltkrieg erhalten blieb. Daneben baute man später eine neue Kirche, die den Namen der alten trägt: Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Sie besteht aus zwei Teilen – der achteckigen Kirche selbst und dem rechtwinkligen Glockenturm. Beide Gebäude mit sehr modernem Design bestehen aus Glas, eingesetzt in Beton-Waben. Die Berliner nennen diese Kirche „die Blaue“, weil beide Gebäude von innen heraus geheimnisvoll in blauer Farbe leuchten. Das Besondere liegt in der Innenbeleuchtung und in der gesamten Baustruktur. In mein Gedächtnis eingeprägt haben sich auch das durchbrochene Gebäude des Europa-Centers und das dahinter stehende Hochhaus aus Glas und Beton mit dem sich auf dem Dach drehenden „Mercedes-Stern“.
Ich ließ den Bahnhof hinter mir zurück und fand mich auf der bekannten Hauptstraße West-Berlins wieder – dem Ku'damm. Auf dem Platz, wo diese Straße ihren Anfang nimmt, erhebt sich das in aller Welt bekannte Symbol West-Berlins – das im Herbst 1943 bei einem Bombenangriff der Alliierten zerstörte Gebäude der Gedächtniskirche, deren Ruine als Mahnmal zur Erinnerung an den 2. Weltkrieg erhalten blieb. Daneben baute man später eine neue Kirche, die den Namen der alten trägt: Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Sie besteht aus zwei Teilen – der achteckigen Kirche selbst und dem rechtwinkligen Glockenturm. Beide Gebäude mit sehr modernem Design bestehen aus Glas, eingesetzt in Beton-Waben. Die Berliner nennen diese Kirche „die Blaue“, weil beide Gebäude von innen heraus geheimnisvoll in blauer Farbe leuchten. Das Besondere liegt in der Innenbeleuchtung und in der gesamten Baustruktur. In mein Gedächtnis eingeprägt haben sich auch das durchbrochene Gebäude des Europa-Centers und das dahinter stehende Hochhaus aus Glas und Beton mit dem sich auf dem Dach drehenden „Mercedes-Stern“.
Elegant gekleidete Menschen bewegten sich auf dem Ku'damm – vorbei an einer Fülle von Geschäften, exklusiven Boutiquen, Restaurants, Banken, Handels- und Geschäftszentren. An den Gebäuden, die wie Paläste wirkten, flimmerten bunte Reklamelichter, die die Betrachter umwarben: Kauft! Kommt zu uns! Kostengünstige Reisen! An den Tischen der zahlreichen Straßencafés saßen hübsch gekleidete Leute, viele von ihnen mit Kindern. Alles atmete Gelassenheit und zeugte von Reichtum und Pracht.
Ja, das war tatsächlich eine vollkommen neue, mir unbekannte Welt – mit einer anderen Mentalität. Hier lebte man nach anderen Gesetzen! Natürlich war mir klar, dass ich in diesem Augenblick sozusagen nur das prächtige, repräsentative Parade-Schaufenster sah, dennoch war ich überwältigt. Wie verzaubert stand ich auf der Straße am Eingang zur U-Bahn-Station „Am Kurfürstendamm“ – direkt im Zentrum West-Berlins und ich tauchte in diese unwirklich anmutende Atmosphäre ein und versuchte, das Unmögliche und Phantastische zu erfassen – und konnte es kaum glauben: Ich bin in einer anderen Welt! Ich bin im Westen!
(Übersetzung aus dem Russischen ins Deutsche Konrad Geburek)
Die Sonne in der Nacht
(Kosmisches Märchen für Erwachsene)
Es war einmal ein Mensch, der lebte auf einem kleinen, fernen Planeten, am Rande des grenzenlosen Universums. Er war ganz einsam – außer ihm lebten hier nur wilde Tiere, Schlangen und Insekten. Der Planet befand sich so weit weg, dass es dort sehr kalt und dunkel war, denn nicht ein einziger Lichtstrahl erreichte seine Oberfläche. Doch der Mensch nähte sich aus den Fellen der Tiere warme Kleidung und arbeitete, damit er sich erwärmen konnte. Er hatte es gelernt, die Dinge, die er brauchte, durch Abtasten zu finden. So war er im Großen und Ganzen mit seinem Leben zufrieden. Aber der Traum von Wärme und Licht verließ ihn nie.
Und einmal, er war gerade in seiner Höhle erwacht, sah er am schwarzen und bis zu diesem Zeitpunkt leeren Himmel einen kleinen Stern. Er leuchtete und glänzte, doch er war so klein und weit entfernt, dass sein Licht ganz schwach erschien und seine Wärme überhaupt nicht zu spüren war. Aber die Augen des Menschen hatten sich so sehr an die Dunkelheit gewöhnt, dass sie sogar in diesem trüben Licht die Umrisse der Gegend zu unterscheiden begannen und auch vieles von dem, was ringsum vor sich ging. Und dem Menschen wurde es gleich leichter ums Herz. Jetzt konnte er stundenlang auf „seinen Stern“ schauen und sogar mit ihm sprechen, wenn ihm traurig zumute war. Aber „sein Stern“ konnte ihm in keiner Weise helfen – denn er war ja so weit entfernt! Und da beschloss der Mensch, zu ihm hinzufliegen. Er baute ein Raumschiff und lenkte es zu diesem fernen, doch für ihn so nahe gewordenen Stern.
Was für eine herrliche Zeit war das doch! Anscheinend änderte sich nichts rings umher, doch der Mensch wusste, dass er sich seinem Traum immer mehr annäherte. Und tatsächlich: „sein Stern“ kam mit jedem Tag näher und näher. Und immer mehr wärmten seine Strahlen, und immer stärker zog er den Menschen zu sich. Die Motoren des Raumschiffs wurden nicht mehr benötigt, so dass der Mensch sie abschalten konnte. In der sich ausbreitenden Stille leuchtete alles ringsum in den Farben eines zauberhaften kosmischen Regenbogens. Es wurde warm, der Mensch legte die Kleidung ab und warf sie in die hinterste Ecke seines Raumschiffes. So verging die Zeit.
Doch allmählich verstärkten sich Licht und Hitze im Raumschiff immer mehr, und dem Menschen wurde plötzlich die Gefahr bewusst. Die Zukunft erschien ihm schon nicht mehr so glücklich, und Angst begann sich seiner zu bemächtigen. Er war jedoch noch überzeugt, dass er zu jeder beliebigen Zeit den Kurs seines Raumschiffes ändern könne. Beruhigt und glücklich darüber, dass er sich nicht von „seinem Stern“ trennen musste, setzte der Mensch den Weg dorthin fort und freute sich an dessen Licht und Schönheit.
Und „sein Stern“ kam immer näher. Bald verstärkte sich sein Licht so sehr, dass der Mensch die Augen mit dunklen Gläsern bedecken musste, um nicht zu erblinden. Dadurch waren die Gegenstände ringsum alle nicht mehr zu sehen, und der Mensch fing wieder an, sie durch Abtasten zu finden. Erneut musste er die alten Felle anziehen, die ihn jetzt nicht wärmten, sondern im Gegenteil, vor der unerträglichen Hitze schützten. Die meiste Zeit verbrachte er jetzt in der finstersten Ecke seines Raumschiffes, welches seiner alten Höhle immer mehr ähnlich wurde.
Und das Raumschiff kam dem Stern immer näher. Der nahm jetzt schon den halben Himmel ein. Durch die unerträgliche Hitze wurden die Brennstofftanks zerstört und der austretende Treibstoff verdampfte augenblicklich im kosmischen Vakuum. Es wird Zeit! - dachte der Mensch in seiner Angst und beschloss den Kurs zu ändern. Doch da es keinen Treibstoff mehr gab, blieben die Motoren stumm. Das Raumschiff ließ sich nicht mehr steuern, es flog weiter und raste unaufhaltsam in die Umarmung des glühenden Abgrunds.
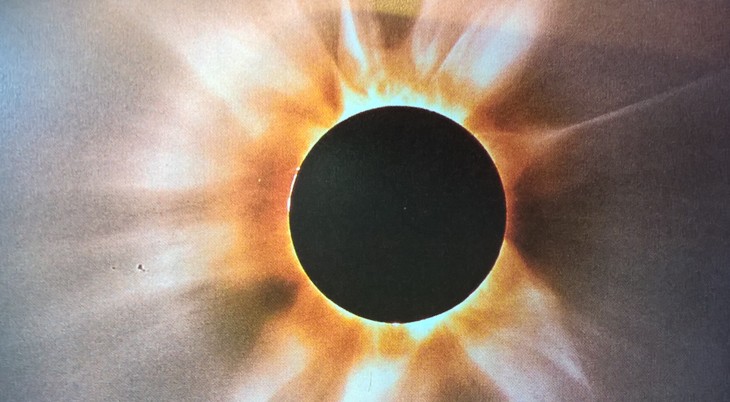
„Es ist besser, wenn das Glück den Menschen sucht und nicht der Jüdische Weishei
